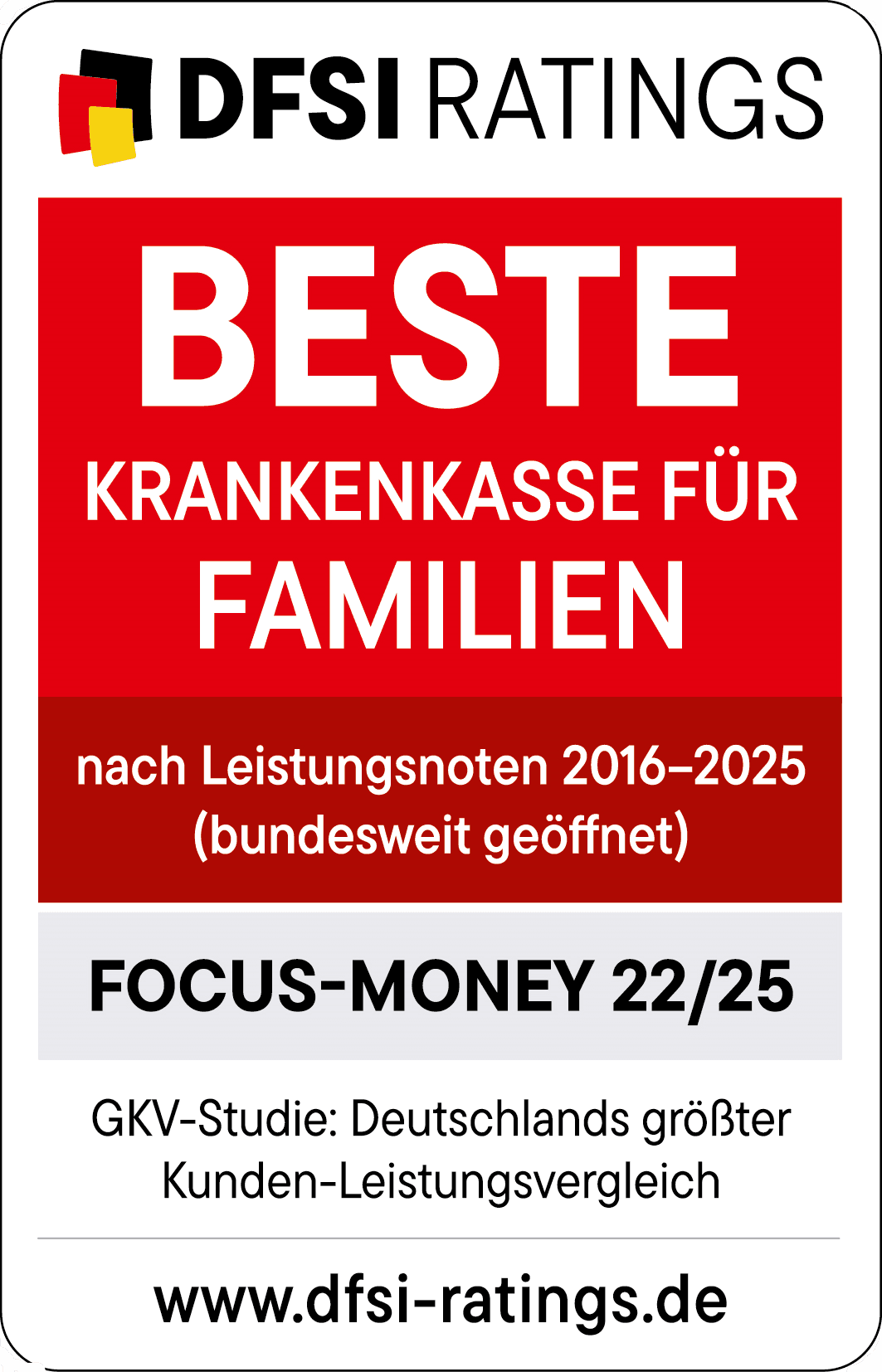Toxic Positivity: Warum #goodvibesonly keine gute Idee ist

Toxic Positivity bezeichnet das Bestreben, jedes negative Gefühl durch etwas Positives ausgleichen zu wollen. Das wirkt im ersten Moment vielleicht hilfreich, kann jedoch Schaden anrichten. Die Psychologin Doris Röschmann erklärt, welche Probleme zwanghafte Positivität mit sich bringt und wie die Balance zwischen authentischem Gefühlserleben und positivem Mindset gelingt.
Bisher galt ein positives Mindset als erstrebenswert. Nun soll zu viel Positivität nicht gut sein. Was ist denn der Unterschied?
Optimismus ist eine innere Einstellung, eine Grundhaltung, mit der wir dem Leben begegnen. Optimismus verhindert aber nicht, dass ich betrübt oder enttäuscht bin, mich ärgere, zweifle, Kränkung oder Zurückweisung empfinden kann. Dennoch gibt es tief in mir die Haltung, dass das vorbeigeht und beim nächsten Mal besser läuft. Das ist etwas, auf das ich immer wieder zurückgreifen kann und was im Alltag als echte Kraft wirksam wird.
Und die zwanghafte Positivität?
Der Zwang, gleich wieder zu lächeln, in allem etwas Gutes zu sehen und die Enttäuschung, Wut oder Kränkung nicht fühlen zu können, sorgt dafür, dass man Gefühle aktiv unterdrückt. Ich spreche in diesem Zusammenhang von ungefühlten Gefühlen.
Was meinen Sie damit genau?
Gefühle sind Botschafter für Bedürfnisse. Negative Gefühle wie Ärger, Trauer, Wut, Scham und Frustration wollen darauf aufmerksam machen, dass das psychische Gleichgewicht gestört ist. Ärger empfinden wir zum Beispiel, wenn wir uns nicht wahr- oder ernstgenommen fühlen, wir fühlen uns beschämt, wenn wir ausgelacht werden. Wenn man das alles übergeht und nicht wahrnehmen will, dann kann die Psyche eine Situation nicht wirklich verdauen. Gefühle wollen wahrgenommen, benannt und korrekt eingeordnet werden. Nur so können wir aus einer Situation lernen und unsere Schlüsse ziehen. Wenn ich nicht daraus lerne, kann ich nicht zu einer echten positiven Kraft zurückfinden. Mir zum Beispiel einen neuen Arbeitsplatz suchen oder eine Beziehung beenden, die mir nicht guttut. Dadurch kann ich auch verhindern, unbewusst immer wieder in dieselben Situationen zu geraten.
Welche Probleme entstehen noch, wenn wir negative Gefühle durch positive überlagern?
Wenn ich Empfindungen langfristig unterdrücke, sorgt das für eine Verflachung der Gefühle – sowohl der positiven als auch der negativen. Man braucht immer stärkere äußere Anreize, um zum Beispiel Freude zu spüren. Das führt zu einem sehr veräußerlichten Leben. Wenn ich mein Leben darauf ausrichte, was ich tue und erschaffe, kommt diese Freude von innen und macht mich unabhängig.
Wer nicht authentisch über sein Inneres spricht, kann keine tiefe Bindung mit jemandem eingehen. Beziehungen bleiben oberflächlich. Betroffene nehmen das selbst jedoch gar nicht so wahr, denn das ist ein schleichender Prozess.
Langfristige Problematiken sind eine depressive Grundstimmung, das Gefühl, am eigenen Leben vorbei zu leben sowie psychosomatische Störungen.
Wie kann man die Balance zwischen Positivität und authentischem Gefühlserleben finden?
Positivität ist dann gut, wenn es um Geschehnisse außerhalb der eigenen Gestaltungsmöglichkeiten geht. Wenn ich zum Beispiel im Stau stehe oder die Bahn Verspätung hat. Wobei es nicht darum geht, sich das schönzureden, sich aber eben auch nicht zu ärgern.
In zwischenmenschlichen Situationen, wenn mich jemand zum Beispiel schlecht behandelt, muss ich das auswerten und überlegen: Wie gehe ich beim nächsten Mal vor? Da hat die Psyche die Funktion, sich zu schützen. Und nicht zu sagen „es liegt an mir oder ich muss etwas Positives darin sehen“. Wenn ich die Unterscheidung nicht mache, dann packe ich mein Leben nicht beim Schopfe, sondern bin Situationen immer wieder ausgeliefert.
Also nicht „Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen“?
Wichtig ist, die Gefühle zuzulassen und ernst zu nehmen. Wut beispielsweise wahrzunehmen ist eine sehr vitale Energie. Wenn sie produktiv eingesetzt wird, trägt das dazu bei, das Leben aktiv zu gestalten. Die innere Konfrontation mit den unangenehmen Gefühlen ist notwendig, um ihre Botschaft zu entschlüsseln und daraus Handlungsfähigkeit zu gewinnen.
Wird der Druck durch Social Media und Hashtags wie #goodvibesonly verstärkt?
Was kann man tun, um nicht in die Toxic Positivity-Falle zu tappen?
1. Situation erkennen
Der erste Schritt ist, dass ich registriere, dass ich in die Falle tappe. Dass ich diese neue Norm, alles positiv sehen zu müssen, verinnerlicht habe. Wenn ich das erkannt habe, habe ich schon einen großen Schritt getan.
2. Wahrnehmung schulen
Fragen Sie sich im Laufe des Tages regelmäßig – zum Beispiel morgens und abends – wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen geht. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Gedanken in einem Gefühlstagebuch festhalten. Fünf Minuten am Tag reichen. Diese Selbstreflektion hilft dabei, in eine echte Verbindung mit sich selbst zu kommen, den inneren Kompass auszurichten sowie Gefühle zu benennen und einzuordnen.
3. Üben: Über Gefühle sprechen
Wer weiß, wie sie oder er sich fühlt, kann leichter mit vertrauten Menschen in den Austausch gehen und artikulieren, was in der jeweiligen Situation helfen könnte. Wenn Sie auf die Frage „Wie geht es dir?“ ehrlich antworten und erklären, warum Sie sich zum Beispiel gekränkt fühlen, kann Ihr Gegenüber darauf eingehen. Das eröffnet die Chance, Unterstützung, Empathie oder Solidarität zu erfahren. Werden Gefühle gespiegelt, hilft das, mit ihnen umzugehen.