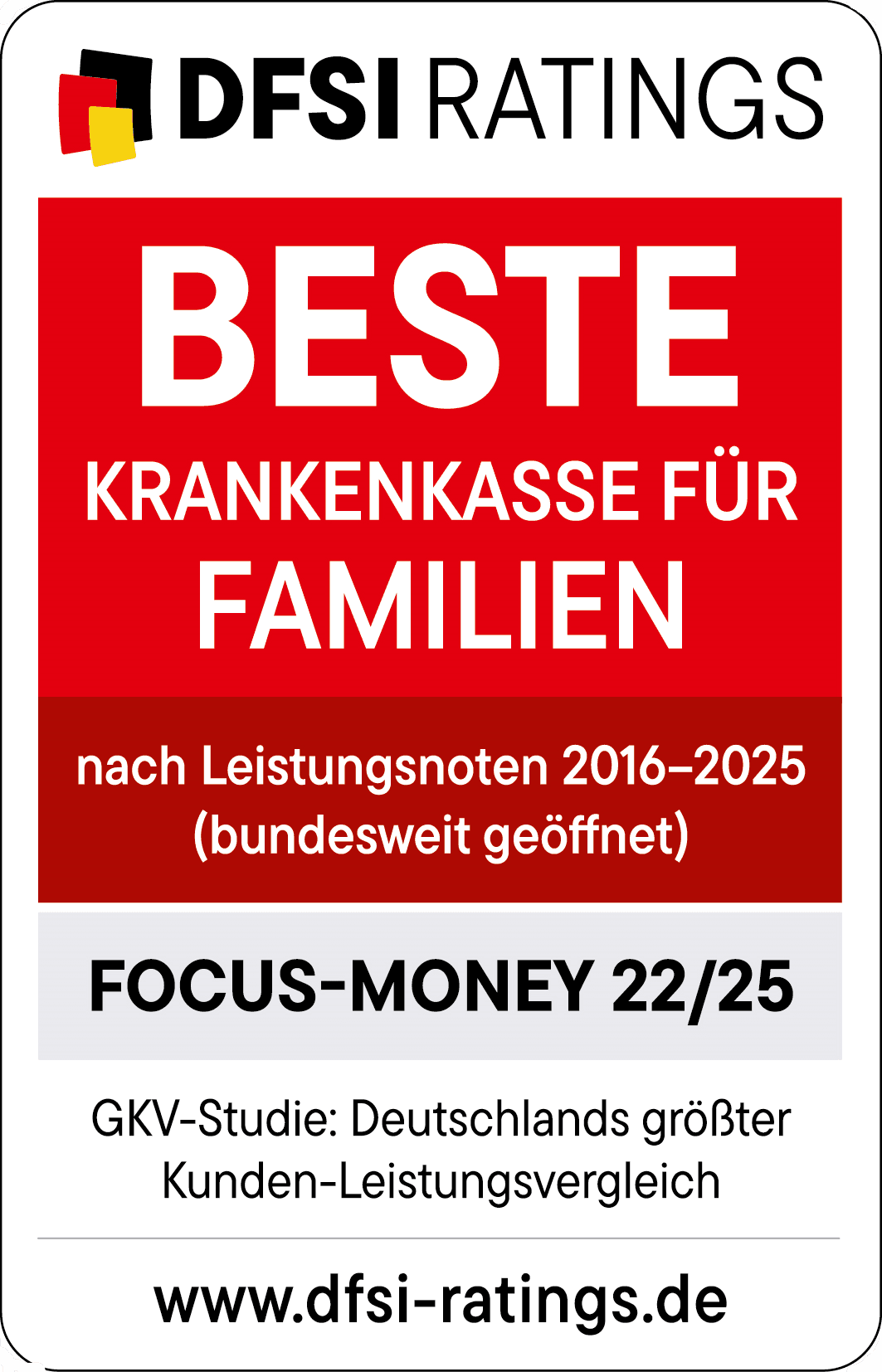Broken-Heart-Syndrom: Warum Patientensicherheit und Aufmerksamkeit lebenswichtig sind

Was ist das Broken-Heart-Syndrom?
Dr. Viola Sinirlioglu: Was ist das Broken-Heart-Syndrom und was sind typische Anzeichen und Symptome?
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher: „Das Broken-Heart-Syndrom, auch Tako-Tsubo-Kardiomyopathie genannt, ist im weiteren Sinne eine Form eines Herzinfarkts. Schon früher wurde beobachtet, dass Patientinnen und Patienten mit typischen Herzinfarktsymptomen vorstellig wurden – bestätigt durch EKG und Laborveränderungen –, bei der Herzkatheteruntersuchung jedoch unauffällige Herzkranzgefäße zeigten. Zunächst schenkte man diesem Phänomen wenig Beachtung, doch spätere Untersuchungen ergaben, dass es sich um eine besondere Form des Herzinfarkts handelt. Dabei kommt es zu einer Verschlechterung der linksventrikulären Pumpfunktion: Die basalen Abschnitte arbeiten normal, während die Spitze des linken Ventrikels und der linken Herzkammer nicht mehr richtig funktionieren. Das typische Bild, das wir im Katheterlabor sehen, erinnert an ein sogenanntes Tako-Tsubo-Gerät – ein bauchiges Gefäß mit engem Hals, das japanische Fischer zum Fangen von Oktopussen verwenden (‚tako‘ = Oktopus, ‚tsubo‘ = Topf).“
Stress als Auslöser des Broken-Heart-Syndroms
Dr. Viola Sinirlioglu: Wie wirkt sich dabei Stress auf das Herz aus?
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher (li.), Kardiologin und Chefärztin der Kardiologie am Marienhospital Wesel, ist bekannt für ihre Arbeit in der Herzmedizin. Sie ist auch Vorständin der Deutschen Herzstiftung. Unsere Beauftragte für Patientensicherheit Dr. Viola Sinirlioglu traf sie zum Interview und sprach mit ihr über die fatalen Folgen von Stress für das Herz.
Beschwerden müssen nicht durch Brustschmerzen auffallen, sondern können sich auch als Bauch- oder Rückenschmerzen oder Übelkeit äußern. Daher sollten Frauen, die merken, dass etwas nicht stimmt, unbedingt ärztlichen Rat suchen.
Dr. Viola Sinirlioglu: Das Broken-Heart-Syndrom tritt zu 90 Prozent bei Frauen auf – warum ist das so?
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher: „Ganz genau weiß man es noch nicht. Man vermutet hormonelle Ursachen oder eine höhere Empfänglichkeit für emotionalen Stress. Fakt ist, dass in solchen Situationen vermehrt Katecholamine – also körpereigene Botenstoffe wie Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin – freigesetzt werden. Diese bewirken eine Vasokonstriktion, also ein Zusammenziehen der kleinen Gefäße, was zu einer Durchblutungsstörung führt. Frauen zeigen zudem häufig untypische Symptome – beim Broken-Heart-Syndrom ebenso wie beim klassischen Herzinfarkt. Beschwerden müssen nicht durch Brustschmerzen auffallen, sondern können sich auch als Bauch- oder Rückenschmerzen oder Übelkeit äußern. Daher sollten Frauen, die merken, dass etwas nicht stimmt, unbedingt ärztlichen Rat suchen – im Zweifel in der Notaufnahme.“
Broken-Heart-Syndrom: Diagnostik und Verlauf
Dr. Viola Sinirlioglu: Wie geht es weiter, wenn man diese Diagnose hat?
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher: „Die weitere Diagnostik erfolgt über eine Herzkatheteruntersuchung. Die Patientinnen werden danach meist auf der Intensivstation überwacht. Es wird genau beobachtet, ob sich die Herzleistung wieder verbessert und ob spezielle Medikamente zur Behandlung der Herzschwäche nötig sind. Die Prognose ist in der Regel gut, jedoch kann es in Einzelfällen zu schwerwiegenden Komplikationen kommen – etwa zu Herzrhythmusstörungen oder anderen Problemen, die auch beim Herzinfarkt auftreten. Denn auch beim Broken-Heart-Syndrom sterben Herzmuskelzellen ab.“
Herzinfarkt bei Frauen
Besser erkennen, vorbeugen und behandeln.
Dr. Viola Sinirlioglu: Welche Rolle spielt Patientensicherheit bei der Herzgesundheit?
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher: „Patientensicherheit bedeutet, Risiken frühzeitig zu erkennen und ernst zu nehmen – auch bei scheinbar harmlosen Symptomen. Das beginnt mit Aufklärung: Menschen müssen die Warnzeichen des Herzens kennen. Ärztinnen und Ärzte sollten besonders bei Frauen aufmerksam sein, um Herzprobleme nicht zu übersehen. In der Versorgung gilt: zuhören, nachfragen, dranbleiben. Für Patientinnen heißt das: lieber einmal zu viel ärztliche Hilfe suchen, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und Medikamente wie verordnet einnehmen.“
Ist das Broken-Heart-Syndrom eine „Frauenkrankheit“?
Etwa 90 Prozent der Betroffenen sind Frauen, meist nach den Wechseljahren.
Dr. Viola Sinirlioglu: Ist das Broken-Heart-Syndrom also eine reine Frauenkrankheit?
Dr. Viola Sinirlioglu: Das heißt, Frauen sollten auf untypische Signale achten?
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher: „Ganz genau. Jede Frau sollte auf ihr Körpergefühl hören. Wenn Sie merken: ‚Etwas stimmt gar nicht, ich fühle mich plötzlich sehr schlecht, das kenne ich so nicht‘ – dann lieber einmal zu viel als zu wenig ärztliche Hilfe suchen. Das ist Teil der Patientensicherheit. Frauen zögern manchmal, weil sie Sorge haben, zu übertreiben. Aber gerade beim Herzen zählt jede Minute.“
Stressbewältigungstraining
Stressbewältigung lässt sich trainieren. Wir bezuschussen den Präventionskurs!
Der Einfluss von Stress auf die Herzgesundheit
Das Broken-Heart-Syndrom zeigt, wie wichtig ein gesunder Umgang mit Stress und eine geschlechtersensible Medizin sind.
Dr. Viola Sinirlioglu: Wie wirkt sich Stress generell auf das Herz aus?
Dr. Viola Sinirlioglu: Ein gesundes Leben ist das A und O für ein starkes Herz. Eine aktuelle Studie von Prof. Magnussen (NEJM) zeigt eindrucksvoll, wie die „Big Five“ Risikofaktoren die Lebenserwartung beeinflussen. Können Sie dazu etwas sagen?
Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher: „Ja, die Studie von Prof. Magnussen vom UKE hat bestätigt, dass die fünf größten Risikofaktoren – Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Übergewicht, Diabetes und Rauchen – das Leben um bis zu zehn Jahre verkürzen können. Wer diese Faktoren durch Prävention und Lebensstilveränderung vermeidet, lebt als Frau bis zu 15 Jahre länger. Auch im höheren Alter lohnt sich eine Umstellung: Schon Gewichtsreduktion, Rauchverzicht und Blutdrucksenkung machen einen großen Unterschied. Viele dieser Dinge haben wir selbst in der Hand – und es geht nicht nur um Lebenszeit, sondern um Lebensqualität.“
Dr. Viola Sinirlioglu: Umso wichtiger ist es, dass auch Krankenkassen über gesunde Lebensführung aufklären.
Herzgesundheit als Lebensaufgabe
Hören Sie auf Warnsignale und suchen Sie frühzeitig Hilfe.
Dr. Viola Sinirlioglu: Frau Prof. Tiefenbacher, was ist Ihre wichtigste Botschaft?
Dr. Viola Sinirlioglu: Frau Prof. Tiefenbacher, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview.
Tipps für mehr Sicherheit als Patientin
- Symptome können sich bei Männern und Frauen unterschiedlich darstellen. Gerade beim Thema Herz kann es sein, dass Frauen eher untypische Symptome aufweisen.
- Machen Sie auf sich aufmerksam und fragen Sie nach, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl!
- Notieren Sie sich Ihre Fragen vor dem Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt und nehmen Sie bei Bedarf eine vertraute Person mit zum Termin.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Symptome, aber keine Diagnose haben, sollten Sie auf Ihren Körper hören und notfalls eine zweite Meinung einholen. Bleiben Sie dran!
Fachbereich der DAK-Gesundheit

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Abnehmen in den Wechseljahren: Tipps von Dr. Alexa Iwan & Prof. Ingo Froböse
Ernährungswissenschaftlerin und Sportwissenschaftler erklären, wie Sie Gewicht halten oder abnehmen – ohne Diät.

Die vier Phasen der Wechseljahre
Wie und wann sie beginnen und wann sie enden

Lipödem
Diese Übersichtsseite bündelt die wichtigsten Informationen zur Erkrankung und verweist auf vertiefende Artikel.