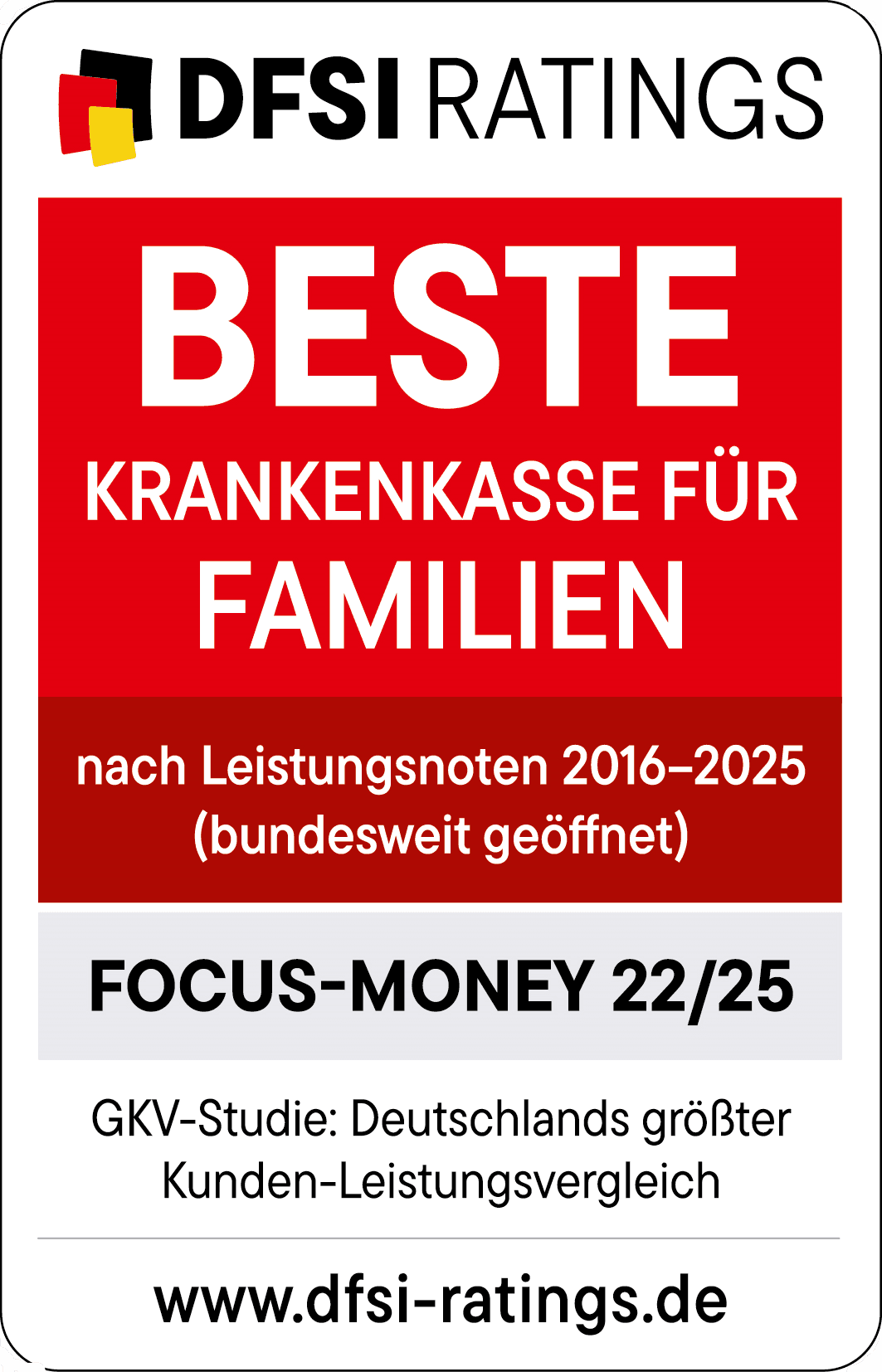Lichttherapie verstehen: Wirkung & praktische Anwendung für die dunkle Jahreszeit

Wer im November morgens zur Arbeit fährt und nachmittags heimkehrt, bekommt oft kaum Tageslicht zu sehen. Das hat Folgen für Wohlbefinden und Gesundheit; der belebende Effekt von Sonnenstrahlen und Tageslicht fehlt uns, die Zeitumstellung kommt on top hinzu. Viele Menschen klagen in der dunklen Jahreszeit über „Winterblues“ mit Stimmungstiefs, Müdigkeit und Heißhunger auf Süßigkeiten – und einige erkranken sogar ernsthaft und entwickeln eine saisonale Depression. Die gute Nachricht: In beiden Fällen kann die Lichttherapie mit Tageslichtlampen helfen und die negativen Begleiterscheinungen der lichtarmen Monate wirksam lindern. Im Folgenden erklären wir, wie du mit der Lichttherapie gut durch die dunkle Jahreszeit kommst.
Was ist eine Lichttherapie?
Doch damit nicht genug: Licht – über das Auge aufgenommen – ist sogar der wichtigste externe Taktgeber für unseren Körper überhaupt. Es justiert zentrale Prozesse täglich neu, indem es unsere innere Uhr steuert, den Hormonhaushalt beeinflusst – und damit auch unsere Stimmung. Hier arbeitet die Lichttherapie mit speziellen Tageslichtlampen und setzt die Augen für einige Minuten künstlichem, hellen Licht mit einer bestimmten Intensität aus, um den Mangel an natürlichem Tageslicht auszugleichen – und so die lichtabhängigen körperlichen Prozesse günstig zu beeinflussen.
Was passiert bei einer Lichttherapie?
Bei einer Lichttherapie findet die Behandlung mit speziellen Tageslichtlampen statt, die meist eine Beleuchtungsstärke von 10.000 Lux erreichen. Zum Vergleich: Die normale Helligkeit in Innenräumen beträgt gerade mal etwa 300 bis 500 Lux.
Für die Behandlung setzt man sich je nach Anweisungen des Herstellers oder des behandelnden Arztes für etwa 20 bis 40 Minuten in einem Abstand von etwa einem halben Meter vor die Lampe. Je weiter man von der Lampe entfernt sitzt, desto schwächer ist die Lichtintensität – und desto länger müsste man sich davor aufhalten, um denselben Effekt zu erzielen.
Wichtig zu wissen: Das Licht der Tageslichtlampe ist hell wie an einem klaren Sommertag, aber die Therapielampen sind mit speziellen Filtern ausgestattet, die die für Augen und Haut potenziell schädliche UV-Strahlung komplett herausfiltern.
Während der Anwendung braucht man nicht starr ins Licht zu starren – es genügt, wenn die Augen regelmäßig dem Licht ausgesetzt sind, zum Beispiel beim Lesen oder Frühstücken. Eine Sonnenbrille darf man dabei allerdings nicht tragen, da sie die Wirkung des Lichts auf den Körper aufheben würde.
So wirkt eine Lichttherapie
Über die Sehnerven gelangt das Lichtsignal in einen winzigen Bereich des Gehirns, den sogenannten Nucleus suprachiasmaticus (SCN). Der SCN sitzt im Hypothalamus und ist unsere „innere Uhr“ also für die Steuerung unseres Tag-Nacht-Rhythmus verantwortlich – und damit für das Gefühl, wann wir uns wach und müde fühlen. Dies steuert er insbesondere durch die Ausschüttung der Hormone Melatonin und Serotonin.
- Melatonin ist das „Schlafhormon“, es wird durch das helle Licht gehemmt. Normalerweise steigt sein Spiegel bei Dunkelheit, macht uns müde und signalisiert dem Körper die Schlafenszeit.
- Serotonin ist ein wichtiger „Glücksbotenstoff“. Er wird bei starkem Licht verstärkt ausgeschüttet, macht uns aktiver und sorgt für gute Laune.
Die Lichttherapie an einem dunklen Spätherbstmorgen sorgt also dafür, dass die Melatonin-Produktion spürbar gebremst wird, indem der Körper das Lichtsignal erhält: der Tag hat begonnen. Wir fühlen uns wacher und, dank aufsteigender Serotoninkurve, auch fröhlicher und aktiver.
Die DAK bezuschusst Tageslichtlampen, die als Medizinprodukt zertifiziert sind, über unser Bonusprogramm DAK AktivBonus.
Wann kann eine Lichttherapie helfen?
Lichttherapie ist überall dort wirksam, wo zu viel Dunkelheit den inneren Rhythmus durcheinanderbringt. Das gilt für
- Saisonal abhängige Depressionen (SAD):
„Winterdepressionen“ sind die bekannteste Indikation für Lichttherapie. Betroffene entwickeln in den dunklen Wintermonaten eine depressive Episode – mit Antriebslosigkeit, gedrückter Stimmung und gesteigertem Schlafbedürfnis. In Studien gibt es Hinweise darauf, dass Lichttherapie hier eine wirksame Behandlungsmethode ist. Das gilt auch für die leichtere Variante, den „Winterblues“, als witterungsbedingten Stimmungsverschlechterung ohne Krankheitswert.
- Depressionen:
Auch bei Depressionen, die unabhängig von der Jahreszeit auftreten, kann Lichttherapie in manchen Fällen günstig wirken. Sie ersetzt hier keine medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung, kann aber Symptome wie Müdigkeit und Niedergeschlagenheit lindern.
- Zeitumstellung und Jetlag:
Wenn die Uhr plötzlich eine Stunde vor- oder zurückgestellt wird oder man durch Zeitzonen gereist ist, gerät die innere Uhr kurzfristig aus dem Takt. Helles Licht am Morgen hilft, sich schneller an den neuen Rhythmus anzupassen.
- Schichtdienst:
Wer nachts arbeiten muss, verletzt den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Der Einsatz der Tageslichtlampe in der Nacht kann dabei helfen, im Job wach und konzentriert zu bleiben, verdunkelnde Maßnahmen nach Schichtende (Sonnenbrille auf der Heimfahrt, dichte Vorhänge, Augenmaske) machen dann das Einschlafen am Morgen leichter.
Welche Nebenwirkungen hat die Lichttherapie?
Insgesamt gilt die Lichttherapie als gut verträglich. Als Nebenwirkungen in den ersten Sitzungen können Kopfschmerzen oder Augenreizungen durch die ungewöhnliche Helligkeit auftreten. Auch Schlafprobleme sind denkbar, falls die Therapie zu spät am Tag durchgeführt wird. Empfehlenswert ist auf jeden Fall, vor Beginn der Lichttherapie ärztliche Rücksprache zu halten. Das gilt besonders bei Erkrankungen mit erhöhter Lichtempfindlichkeit (beispielsweise Lupus erythematodes, Dermatomyositis, Porphyrien), Augenerkrankungen und der gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen (beispielsweise bestimmte Antibiotika oder hochdosiertes Johanneskraut). Auch bei Depressionen oder bipolaren Erkrankungen sollte vor Einsatz der Lichttherapie ärztliche Rücksprache gehalten werden, da das Risiko für Auftreten manischer Episoden erhöht werden kann.
Häufige Fragen zur Lichttherapie mit einer Tageslichtlampe
Wird eine Lichttherapie von der Krankenkasse bezahlt?
Wie oft darf man Lichttherapie machen?
Zur Vorbeugung und Therapie von Tageslichtmangel kann die Lichttherapie in den dunklen Wintermonaten nach Bedarf einmal täglich durchgeführt werden. Eine Wirkung sollte bereits nach einigen Tagen spürbar sein. Wichtig ist, die Therapie morgens zu absolvieren, um optimal vom Wachmach-Effekt des Tageslichtes zu profitieren. Nachmittags oder abends sollte die Tageslichtlampe nicht eingesetzt werden, um den Schlafrhythmus nicht zu stören.
Welche Creme sollte ich nach einer Lichttherapie verwenden?
Nach einer Lichttherapie mit einer Lampe ist in der Regel keine spezielle Creme erforderlich, weil die Haut nicht wie bei Sonnenlicht belastet wird. Falls sich die Haut trocken anfühlt, reicht eine milde, parfumfreie Feuchtigkeitscreme.
Wann darf man keine Lichttherapie machen?
Eine Lichttherapie sollte nicht oder nur nach Rücksprache mit einem Arzt bzw. einer Ärztin durchgeführt werden, wenn bestimmte Erkrankungen oder Risikofaktoren vorliegen. Dazu gehören Augenerkrankungen wie Netzhautschäden, Makuladegeneration oder unbehandeltes Glaukom. Auch erhöhte Lichtempfindlichkeit, beispielsweise durch Hauterkrankungen oder bestimmte Medikamente, kann ein Ausschlusskriterium sein. Bei Depressionen und bipolaren Erkrankungen sollte der Einsatz von Lichttherapie vorher ärztlich besprochen werden, da das Risiko für den Beginn einer manische Episode erhöht werden kann.
Merkblätter zur Vorbereitung auf dein Praxisgespräch
Fachbereich der DAK-Gesundheit

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Gruppentherapie
Seelische Probleme gemeinsam angehen - Vorteile, Kosten, Voraussetzungen.

Psychotherapeutische Behandlung
Erobern Sie Ihr Leben zurück - mit einer psychotherapeutischen Behandlung.

Psychotherapie – Unsere Therapieprogramme
Bei seelischen Problemen, wie z. B. Depressionen, kommt es auf schnelle Hilfe an. Wir helfen Ihnen.