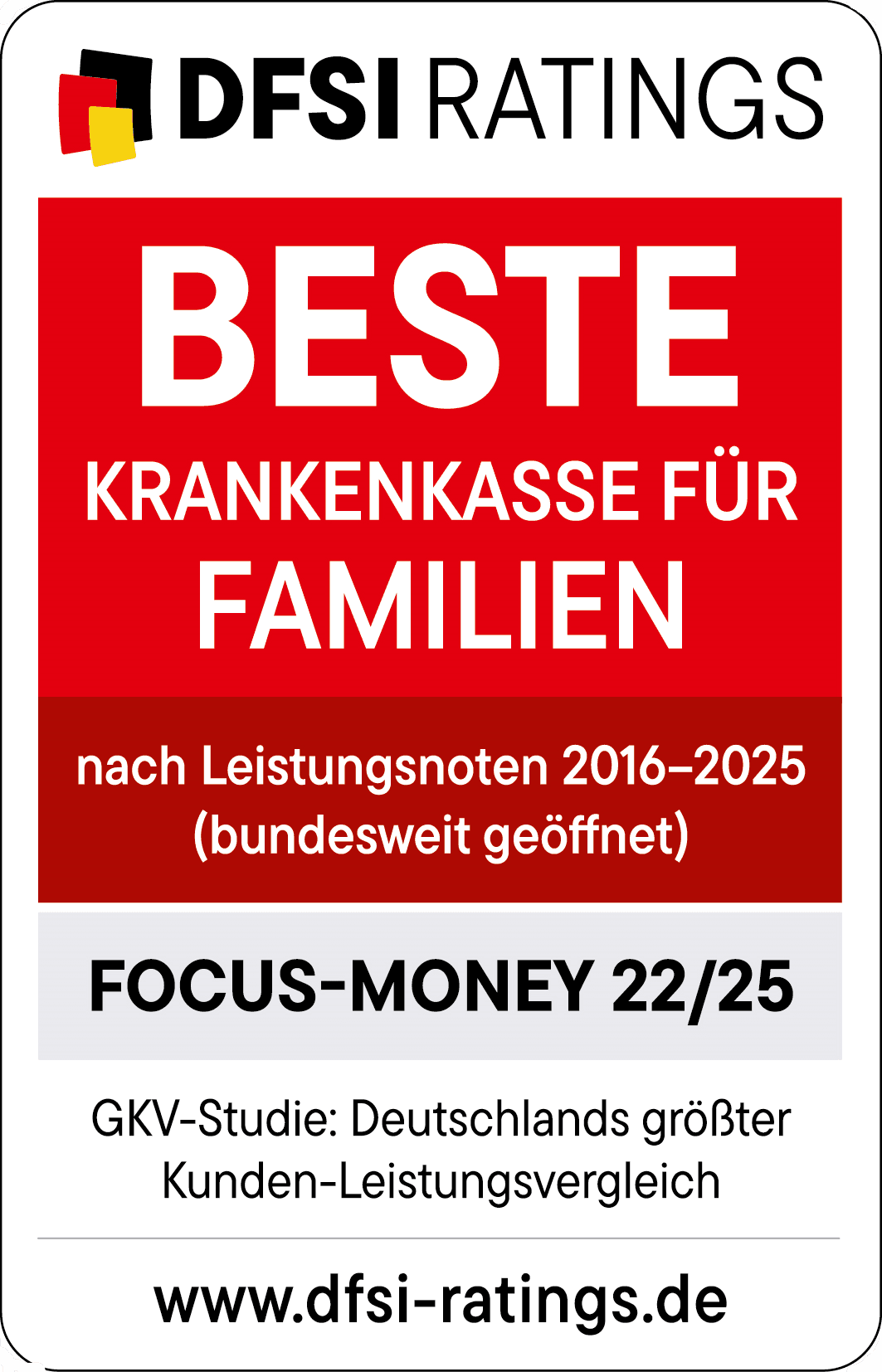Gender Health Gap: Warum Frauen in der medizinischen Versorgung benachteiligt sind

Der Gender Health Gap beschreibt den Unterschied in der medizinischen Versorgung und Forschung von Frauen und Männern. Während männliche Körper seit Jahrzehnten als Standard in Studien und Diagnostik gelten, werden die Besonderheiten weiblicher Gesundheit oft übersehen. Die Folgen reichen von Fehldiagnosen über verspätete Therapien bis hin zu vermeidbarem Leid.
So erging es auch Christina Pingel. Im Gespräch mit unserer Beauftragten für Patientensicherheit berichtet sie von ihren Erfahrungen mit dem Gender Health Gap und gibt wichtige Tipps, wie Sie als Frau für Ihre Patientensicherheit sorgen können.
Wie mein Geschlecht die Diagnose verzögerte: Erfahrungen mit dem Gender Health Gap
Dr. Viola Sinirlioglu: „Frau Pingel, Sie haben die Auswirkungen des Gender Health Gap persönlich zu spüren bekommen. Was ist Ihnen passiert und was ist falsch gelaufen?“
Christina Pingel: „Ich war etwa 26 Jahre alt, als bei mir die ersten Symptome auftraten: starke Erschöpfung, Herzrasen, Druck auf der Brust und Herzrhythmusstörungen. Zunächst suchte ich meine hausärztliche Praxis auf, von dort wurde ich mit einer Überweisung an einen Kardiologen weitergeleitet. Die Diagnose lautete: eine leichte Mitralklappeninsuffizienz – „nichts Besorgniserregendes“, wie es hieß. Ich sei schließlich noch jung und gesund und eine Frau.
Christina Pingel schreibt auf Instagram über mentale Gesundheit, Angststörungen, Panikattacken und depressive Episoden. Seit einer schweren Herz-OP widmet sie sich verstärkt dem Thema Gender Health Gap. Ihre Erfahrungen schildert sie in ihrem Buch "Diagnose: Frau" (Piper Verlag).
In den folgenden Jahren verschlechterte sich mein körperlicher und psychischer Zustand zunehmend. Ich wandte mich immer wieder an medizinisches Fachpersonal unterschiedlicher Fachrichtungen. Doch meine Beschwerden wurden wiederholt nicht ernst genommen und als „psychosomatisch“ abgetan. Zahlreiche Nächte verbrachte ich in Notaufnahmen, wurde aber immer wieder mit ähnlichen Aussagen entlassen: „Da ist nichts, Sie bilden sich das nur ein.“
Diese Erfahrungen sind ein gutes Beispiel dafür, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen im medizinischen Kontext suggeriert wird, dass ihre Symptome nicht real oder übertrieben seien. Besonders häufig sind davon Frauen, inter, nicht-binäre, trans und andere marginalisierte Personen betroffen. Ihre Beschwerden werden häufiger bagatellisiert, falsch interpretiert oder ausschließlich psychologisiert.“
Dr. Viola Sinirlioglu: „Warum spielte es dabei eine Rolle, dass sie eine Frau sind?“
Christina Pingel: „Die Tatsache, dass ich eine Frau bin, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Unsere medizinische Forschung und Praxis basiert historisch überwiegend auf cis-männlichen* Normwerten. Abweichungen davon – etwa bei Frauen oder queeren Personen – führen häufig zu Fehldiagnosen oder unzureichender Behandlung.“
* Cis-männlich beschreibt eine Person, der bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde und die sich auch als Mann identifiziert.
Gender Health Gap – und seine Folgen für Frauen
- Frauen erhalten später Diagnosen – insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Eine Studie im Journal of the American Heart Association (2018) zeigt, dass Frauen mit
Herzinfarkt seltener korrekt diagnostiziert und behandelt werden als Männer.¹- Frauen berichten häufiger, dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden.
Laut einer Umfrage der British Heart Foundation (2020) glauben 50 % der Frauen, dass sie
bei einem Herzinfarkt nicht ernst genommen würden.²- In klinischen Studien sind Frauen sowie trans*, inter* und nicht-binäre Personen stark unterrepräsentiert.³
„Symptome bei FLINTA*-Personen (Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen) werden häufig als emotional, stressbedingt oder „überempfindlich“ abgetan – besonders, wenn sie nicht in das klassische Bild eines „männlichen“ Krankheitsverlaufs passen.
In meinem Fall dauerte es zehn Jahre, bis ich auf eine Kardiologin traf, die meine Beschwerden ernst nahm und mich gründlich untersuchte. Sie stellte eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz fest. Drei Monate später wurde ich am Herzen operiert – ein Eingriff, der vielleicht deutlich früher hätte stattfinden können, wenn man meine Symptome von Anfang an ernst genommen hätte.“
Mein Fall steht stellvertretend für viele andere. Er zeigt, wie gefährlich strukturelle Ungleichheiten im Gesundheitswesen sein können – und dass geschlechtssensible, inklusive und diskriminierungskritische Medizin kein „Nice-to-have“, sondern ein Gebot der Patient*innensicherheit ist.
So wirkt sich der Gender Health Gap auf meine Patientensicherheit aus
Dr. Viola Sinirlioglu: „Warum ist es für Patientensicherheit wichtig, Geschlechterunterschiede zu beachten?“
Christina Pingel: „Weil geschlechtsspezifische Unterschiede in der Medizin real sind – und ignoriert werden. Für die Sicherheit von Patientinnen und Patienten ist es entscheidend, dass biologische, soziale und kulturelle Unterschiede zwischen Geschlechtern in Diagnostik, Therapie und Forschung berücksichtigt werden. Tun wir das nicht, entstehen Versorgungslücken – wie in meinem Fall.
Herzinfarkt bei Frauen
Besser erkennen, vorbeugen und behandeln.
Viele Krankheiten verlaufen bei FLINTA-Personen anders als bei cis-Männern. Ein klassisches Beispiel ist der Herzinfarkt: Während bei Männern oft der typische Brustschmerz im Vordergrund steht, zeigen Frauen häufiger untypische Symptome wie Übelkeit, Rückenschmerzen oder Erschöpfung. Wenn medizinisches Personal nicht geschult ist, diese Unterschiede zu erkennen, bleibt die Erkrankung oft unentdeckt – oder wird, wie bei mir, als „psychosomatisch“ abgetan."
Patient*innensicherheit bedeutet, alle Körper mitzudenken – nicht nur den männlichen Normkörper. Geschlechtersensible Medizin ist kein Sonderfall, sondern ein notwendiger Bestandteil moderner, fairer Gesundheitsversorgung.
„Auch Medikamente wirken unterschiedlich – abhängig vom Hormonhaushalt, vom Stoffwechsel, vom Körpergewicht. Trotzdem werden einige Arzneimittel noch immer primär an cis-männlichen Probanden getestet. Das bedeutet: Nebenwirkungen, Dosierungen und Wirksamkeit sind für andere Geschlechter oft schlechter erforscht – und damit weniger sicher.
Hinzu kommen strukturelle Vorurteile: Studien zeigen, dass FLINTA-Personen häufiger nicht ernst genommen, häufiger unterbrochen und seltener umfassend untersucht werden. Das ist kein individuelles Versagen einzelner Ärzte und Ärztinnen, sondern ein strukturelles Problem.
In meinem Fall führte genau das dazu, dass meine Beschwerden über Jahre verkannt wurden. Erst nach einem Jahrzehnt wurde meine Herzerkrankung ernst genommen und korrekt diagnostiziert. Eine frühzeitige Behandlung hätte mein Leiden deutlich verkürzen – und potenziell gesundheitliche Risiken reduzieren – können."
Trotz Gender Health Gap: Das kann ich tun, um richtig versorgt zu werden
Dr. Viola Sinirlioglu: „Wenn Sie das Ganze noch einmal erleben würden: Was würden Sie anders machen? Was würden Sie anderen raten, wie können sie selbst dafür sorgen, dass sie sicher versorgt sind?“
Christina Pingel:
Mein wichtigstes Learning ist: Vertraut euch selbst.
Was ich heute anders machen würde? Ich würde meine eigene Wahrnehmung nicht mehr so leicht infrage stellen. Ich habe gelernt: Auch medizinisches Fachpersonal kann sich irren oder von Vorannahmen beeinflusst sein – gerade dann, wenn Geschlecht, Herkunft, Alter oder sozialer Status unbewusst mitbewertet werden.
Gendermedizin
Ziel der Gendermedizin ist es, dass alle eine medizinische Versorgung erhalten, die zur Person und zum Geschlecht passt.
Und genau das ist Teil eines größeren, strukturellen Problems: Unser Gesundheitssystem ist noch immer auf den cis-männlichen Körper und die dazugehörige Normerwartung ausgerichtet. Menschen, die davon abweichen, erleben häufiger, dass ihre Beschwerden nicht erkannt, nicht ernst genommen oder falsch eingeordnet werden. Es geht hier nicht um Einzelfälle, sondern um ein System, das viele systematisch ausschließt – oft unbewusst, aber mit realen Folgen. Und genau dieser Punkt ist einer der wichtigsten."
Was wir brauchen, sind mehr Bewusstsein und mehr Solidarität. Wenn wir offen über solche Erfahrungen sprechen, benennen wir Missstände. Und nur wenn wir sie benennen, können wir sie gemeinsam verändern.
Tipps für mehr Sicherheit als Patientin
- Symptome können sich bei Männern und Frauen unterschiedlich darstellen. Gerade beim Thema Herz kann es sein, dass Frauen eher untypische Symptome aufweisen.
- Machen Sie auf sich aufmerksam und fragen Sie nach, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl!
- Notieren Sie sich Ihre Fragen vor dem Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt und nehmen Sie bei Bedarf eine vertraute Person mit zum Termin.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Symptome, aber keine Diagnose haben, sollten Sie auf Ihren Körper hören und notfalls eine zweite Meinung einholen. Bleiben Sie dran!
Fachbereich der DAK-Gesundheit

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Frauengesundheit
Regelschmerzen, Blasenentzündungen, Menopause und Co.: Frauen sind von speziellen Beschwerden betroffen.

Vorsorgeuntersuchungen für Frauen
Der beste Schutz für Ihre Gesundheit

Abnehmen in den Wechseljahren: Tipps von Dr. Alexa Iwan & Prof. Ingo Froböse
Ernährungswissenschaftlerin und Sportwissenschaftler erklären, wie Sie Gewicht halten oder abnehmen – ohne Diät.