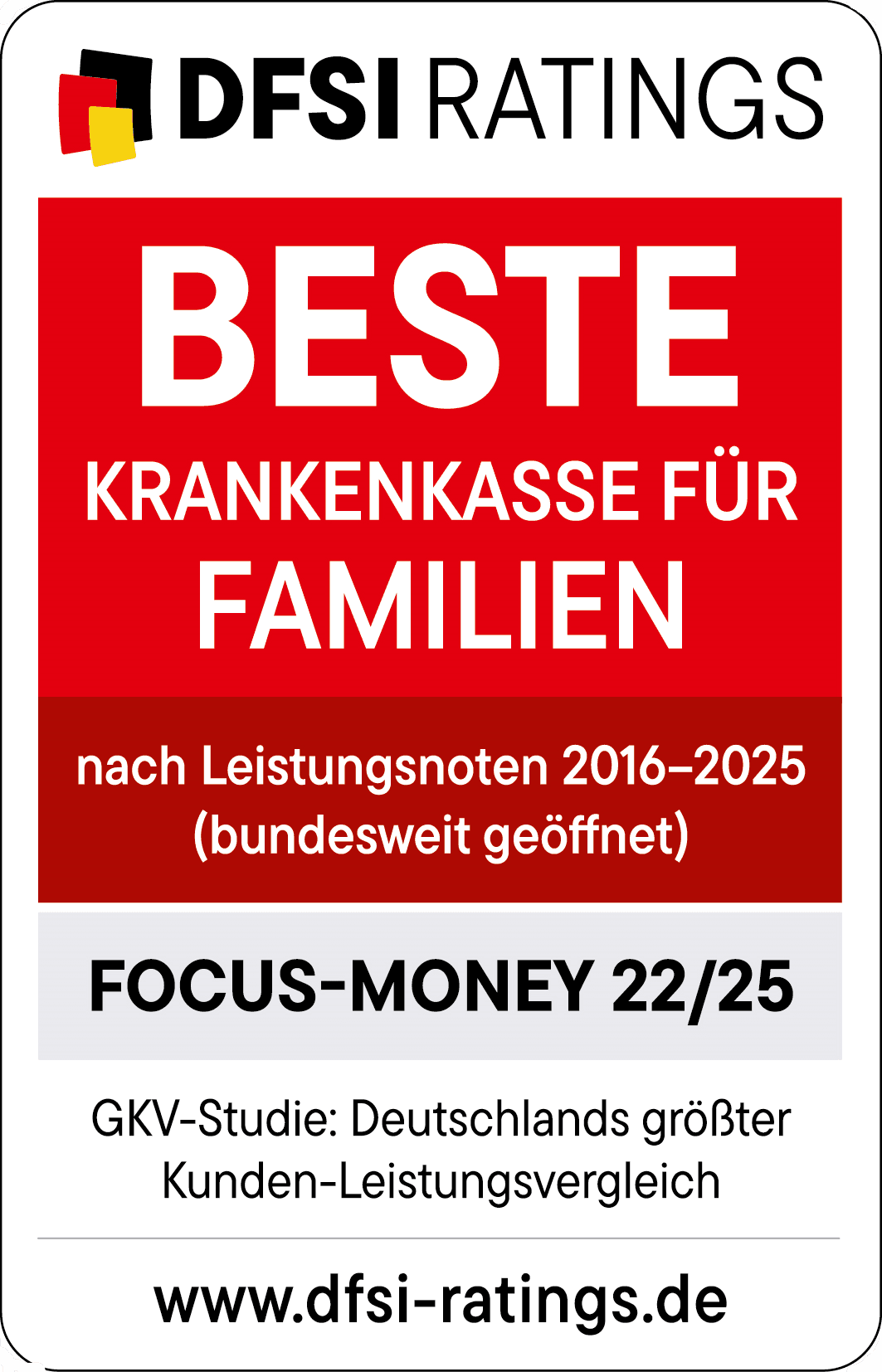Was ist Gendermedizin?

Haben Sie sich schonmal gefragt, warum Medikamente bei manchen Menschen anders wirken? Oder warum Beschwerden manchmal übersehen oder falsch eingeordnet werden – je nachdem, welches Geschlecht jemand hat? Genau hier setzt die Gendermedizin an.
Sie beschäftigt sich damit, wie sich biologisches und soziales Geschlecht auf die Gesundheit auswirken. Denn ja: Unser Körper, unsere Hormone, unsere Lebensrealität – all das spielt eine Rolle, wenn es um Krankheiten und ihre Behandlung geht. Das Ziel der Gendermedizin ist, dass alle eine medizinische Versorgung bekommen, die wirklich zu der jeweiligen Person und ihrem Geschlecht passt. Unabhängig davon, ob sie männlich, weiblich, trans*, inter* oder nicht-binär sind. Wir informieren Sie hier über wichtige Grundlagen und aktuelle Herausforderungen der Gendermedizin.
Warum betrifft geschlechtersensible Medizin alle?
Zum Beispiel:
- Männer mit Depressionen zeigen oft andere Symptome als Frauen – werden aber seltener richtig diagnostiziert.
- Frauen bekommen häufiger Fehldiagnosen – oder hören, dass „das psychisch“ sei.
- Trans* und nicht-binäre Menschen haben oft Schwierigkeiten, passende medizinische Hilfe zu finden.
Und genau hier will die Gendermedizin ansetzen: Unterschiede erkennen und nutzen – für eine bessere, individuellere Behandlung.
Biologisches und soziales Geschlecht: Was ist der Unterschied?
In der Medizin wird zwischen zwei Ebenen unterschieden:
- Biologisches Geschlecht: Körperliche Merkmale wie Hormone, Chromosomen oder Organe.
- Soziales Geschlecht: Wie jemand sich selbst sieht, lebt und welche Rolle die Gesellschaft dabei spielt.
Beides wirkt sich auf die Gesundheit aus. Hormone beeinflussen zum Beispiel, wie Medikamente wirken. Und wer sich mit Beschwerden schämt oder nicht ernst genommen fühlt, geht vielleicht später zur Ärztin oder zum Arzt – oder gar nicht.
Konkrete Geschlechterunterschiede in der Medizin
Dass Männer und Frauen unterschiedliche Symptome zeigen oder Medikamente verschieden vertragen, zeigt sich besonders deutlich bei konkreten Krankheitsbildern:
| Krankheit | Symptome Männer | Symptome Frauen |
| Herzinfarkt | Brustschmerz, Druck auf der Brust, linker Arm | Übelkeit, Atemnot, Rückenschmerzen, Erschöpfung - mehr über Herzinfarkt bei Frauen |
| Depression | Reizbarkeit, Rückzug, Alkoholmissbrauch | Antriebslosigkeit, Traurigkeit, Schlafprobleme |
| Osteoporose | Später erkannt, da „klassische Frauenkrankheit“ | Häufiger diagnostiziert, aber auch oft zu spät behandelt |
Man sieht: Wer nicht genau hinschaut, verpasst schnell wichtige Hinweise. Und das kann ernst werden – gerade in Notfällen. Männer warten oft zu lange mit dem Praxisbesuch, Frauen werden mitunter nicht ernst genommen – und für viele trans* oder nicht-binäre Menschen fehlen überhaupt passende Angebote.
Gendermedizin: Medikamente und ihre Wirkung
Viele Medikamente wurden früher fast ausschließlich an männlichen Probanden getestet. Das führte dazu, dass heute oft noch eine „Einheitsdosis“ gilt, die aber nicht für alle passt, denn zum Beispiel:
- verstoffwechseln Frauen Wirkstoffe anders,
- spielen der Zyklus oder die Wechseljahre eine Rolle,
- Frauen benötigen teilweise eine geringere Dosis.
Vor allem Hormone beeinflussen die Wirkung von Arzneimitteln. Schlafmittel wirken bei Frauen zum Beispiel oft länger und stärker – was wiederum ihr Risiko für Nebenwirkungen wie Schwindel oder Stürze erhöht.
Auch hormonelle Therapien bei trans* Personen erfordern individuelle Anpassungen. Doch da fehlen bislang oft noch klare medizinische Leitlinien.
Gendermedizin: Forschung, aktueller Stand und Herausforderungen
Gendermedizin ist längst mehr als ein Nischenthema und sowohl in der Politik als auch in der Forschung stärker ins Bewusstsein gerückt. Doch wie weit sind wir wirklich? Und wo gibt es noch Lücken? Die gute Nachricht: Es tut sich was! Studien werden vielfältiger, Kliniken spezialisieren sich. Aber es bleibt auch noch viel zu tun.
Was sich bereits bewegt:
- Forschung wird diverser, zum Beispiel, was Probandinnen und Probanden bei Studien angeht.
- Kliniken spezialisieren sich auf Gendermedizin.
- Die Politik fördert Forschungsprojekte zum Thema.
Was noch fehlt:
- Datenlücken schließen, etwa mit separater Auswertung des Geschlechts in Studien.
- Mehr Wissen in der Ausbildung, also Gendermedizin in Lehrplänen fest verankern.
- Diversität mehr in der Versorgung mitdenken.
- Gesundheitssystem sensibilisieren, damit grundsätzlich an geschlechtsspezifische Unterschiede gedacht wird.
Tipps für geschlechterspezifische Medizin im Alltag
Auch, wenn noch nicht überall geschlechtersensibel gearbeitet wird: Sie können selbst einiges tun, um besser versorgt zu werden – und Ihre individuellen Bedürfnisse zu äußern.
Sprechen Sie das Thema aktiv an
Viele Ärztinnen und Ärzte denken im Praxisalltag (noch) nicht automatisch geschlechtsspezifisch. Aber sie reagieren, wenn Sie das Thema ansprechen. Stellen Sie ruhig Fragen, wie etwa:„Gibt es bei diesem Medikament geschlechtsspezifische Unterschiede?“
„Wurden bei der Therapieauswahl mein Hormonstatus oder Zyklus berücksichtigt?“
Je konkreter Sie nachfragen, desto eher wird das Thema ernst genommen.
- Vertrauen Sie auf Ihr Gefühl und holen Sie sich im Zweifelsfall eine Zweitmeinung
Wenn Sie das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden oder Ihre Symptome werden „wegerklärt“, ist es absolut in Ordnung, eine zweite Meinung einzuholen. Ihre Beschwerden sind real – Punkt.
- Führen Sie Tagebuch über Ihre Symptome und Medikamente
Wenn Sie zum Beispiel regelmäßig Medikamente nehmen oder chronische Beschwerden haben: Schreiben Sie mit! Wann treten welche Symptome auf? In welchem Zyklusabschnitt? Wie lange nach Medikamenteneinnahme? Das hilft Ihnen – und den behandelnden Personen – bei der Ursachenforschung.
Vorsorge für Frauen
Check-up 35, Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs – alle Infos zur kostenlosen Vorsorge.
Häufig gestellte Fragen zur Gendermedizin
Warum wurde Gendermedizin so lange vernachlässigt?
Weil Frauen und andere Geschlechter oft als „zu komplex“ galten – durch Zyklus, Hormone oder Schwangerschaft. Erst in den letzten Jahren wurde ernsthaft erkannt, wie wichtig geschlechtersensible Medizin für eine faire und wirksame Behandlung ist.
Ist Gendermedizin das Gleiche wie Frauengesundheit?
Nein. Gendermedizin beschäftigt sich mit gesundheitlichen Unterschieden aller Geschlechter. Frauengesundheit ist ein Teilbereich, genau wie Männergesundheit oder die medizinische Versorgung von trans* und nicht-binären Personen.
Woran erkenne ich, ob meine Ärztin oder mein Arzt geschlechtersensibel arbeitet?
An einer respektvollen Kommunikation, sensiblen Fragen zum individuellen Hintergrund und daran, dass Unterschiede ernst genommen werden – ohne Klischees. Und wenn Sie sich unsicher sind: Nachfragen ist immer erlaubt.
Fachbereich der DAK-Gesundheit

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Abnehmen in den Wechseljahren: Tipps von Dr. Alexa Iwan & Prof. Ingo Froböse
Ernährungswissenschaftlerin und Sportwissenschaftler erklären, wie Sie Gewicht halten oder abnehmen – ohne Diät.

Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge
Mehr zu Ablauf, Kosten und weitere Informationen zur Vorsorgeuntersuchung.

Frauengesundheit
Regelschmerzen, Blasenentzündungen, Menopause und Co.: Frauen sind von speziellen Beschwerden betroffen.