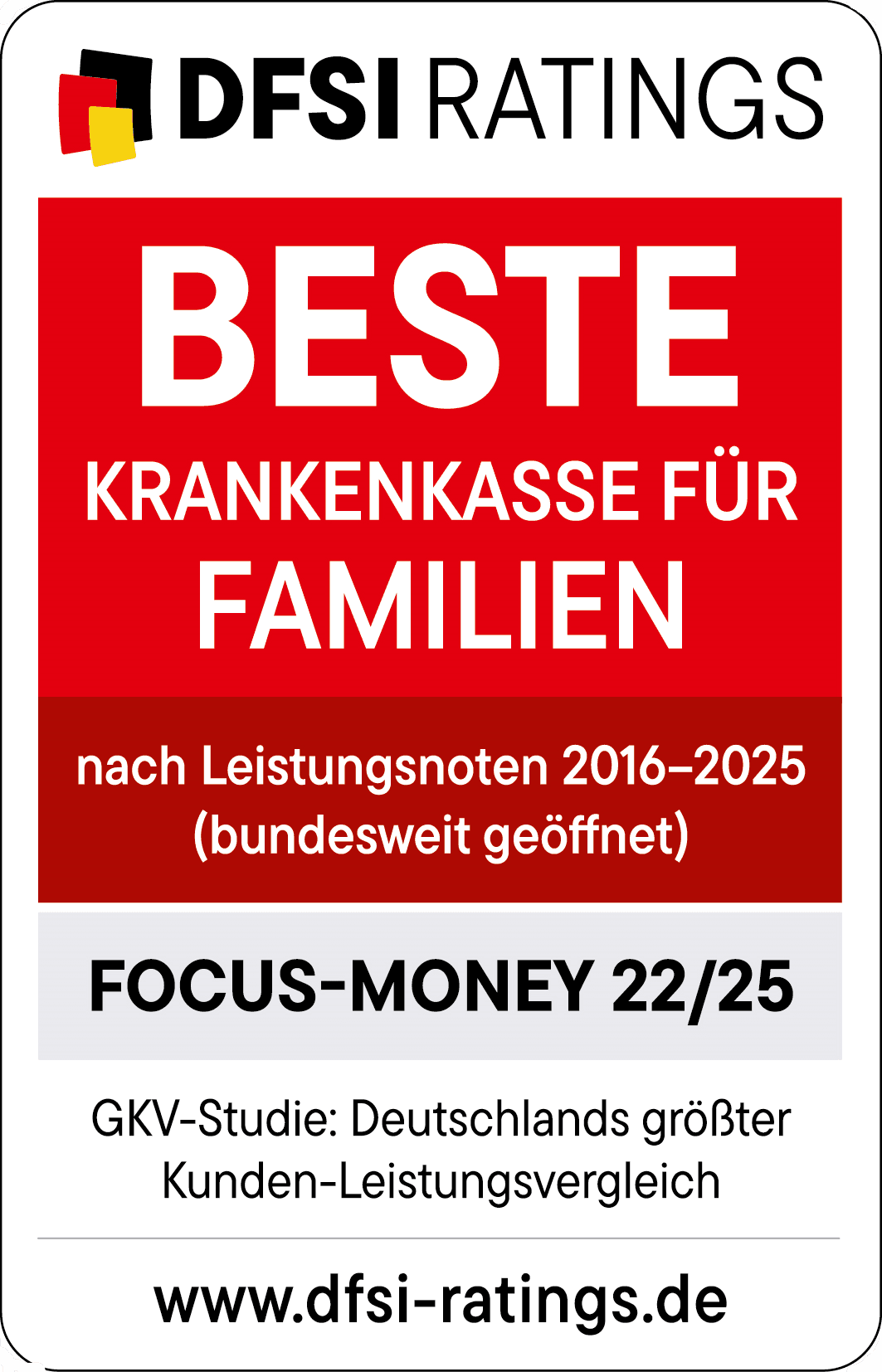Nährwertkennzeichnung: Sorgt der Nutri-Score für mehr Durchblick?

Warum braucht es ein Ampelsystem für Lebensmittel?
Gut zu wissen!
Der Nutri-Score ist eine freiwillige Kennzeichnung. Entscheidet sich ein Hersteller jedoch dafür, das Label zu verwenden, muss es auf all seinen Produkten angeben. Es ist nicht zulässig nur die „gesunden“ Produkte zu labeln.
Wie wird der Nutri-Score berechnet?
Der Nutri-Score erstellt ein Nährwertprofil eines Lebensmittels. Positiv bewertet werden Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, Raps-, Walnuss- und Olivenöl, Ballaststoffe sowie Eiweiß. Negativ ins Gewicht fallen gesättigte Fettsäuren, Zucker, Salz und ein hoher Kaloriengehalt. Die günstigen und ungünstigen Nährstoffe werden miteinander verrechnet. Die Berechnung bezieht sich immer auf 100 Gramm oder 100 Milliliter. Anhand der so ermittelten Punktzahl wird das Lebensmittel einer Kategorie zugeordnet. Je niedriger die Gesamtpunktzahl, desto besser die Bewertung. Die fünfstufige Farbskala reicht von dunkelgrün bis rot und von A bis E. Das System wurde von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt.
So ernähren Sie sich gesund!
Mit Kochvideos und Bewegungstagebuch. Kostenlos und online.
Was sagt der Nutri-Score aus und wie interpretiere ich ihn richtig?
Vorteile des Nutri-Scores
- Das Label ist intuitiv verständlich und auffällig. In vielen Studien in europäischen und außereuropäischen Ländern haben Forschende verschiedene Front-of-pack-Labels verglichen. Dabei haben sie untersucht, ob die Verbraucherinnen und Verbraucher die Labels sehen, ob sie sie verstehen und ob die Kennzeichnung ihr Konsumverhalten beeinflusst. In so gut wie allen Studien hat der Nutri-Score am besten abgeschnitten.
- Der Nutri-Score zeigt zuverlässig, ob ein Nahrungsmittel eher empfehlenswert oder nicht empfehlenswert für die Gesundheit ist, – auch über verschiedene Produktgruppen hinweg. So werden beispielsweise Kekse meist mit C bis E bewertet, während Vollkornprodukte eher in den oberen Kategorien landen. Das entspricht den bekannten Ernährungsempfehlungen.
- Die positive Resonanz führt dazu, dass immer mehr Lebensmittelhersteller und -händler den Nutri-Score verwenden. Damit ihre Produkte einen möglichst guten Nutri-Score erhalten, werden sie motiviert, ihre Rezepturen dahingehend zu verändern. Mittelfristig könnte das zu gesünderen Produkten führen.
- Eine Studie aus Frankreich belegt, dass der Nutri-Score dazu führt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich an der Ladentheke eher für ernährungsphysiologisch günstigere Lebensmittel entscheiden.
Kritik am Nutri-Score
- Konsumentinnen und Konsumenten könnten den Eindruck gewinnen, dass mit A eingestufte Produkte gesund sind und sie sich ausgewogen ernähren, wenn sie hauptsächlich „grüne“ Produkte zu sich nehmen. Doch so einfach ist es nicht. Der Körper benötigt verschiedene Nährstoffe und jeder Organismus ist individuell. Das kann der Nutri-Score nicht abbilden.
- Es werden nicht alle Inhaltsstoffe berücksichtigt: Vitamine und Zusatzstoffe wie Süßstoffe werden vom Nutri-Score nicht in die Bewertung einbezogen. Das ermöglicht Herstellern zum Beispiel, den Zuckergehalt zu senken und den Zucker durch Süßstoffe zu ersetzen. Süßstoff ist jedoch umstritten, sodass das Lebensmittel trotz besserem Nutri-Score nicht unbedingt gesünder wäre.
- Der Nutri-Score vereinfacht stark und fasst Bewertungen in verschiedenen Bereichen zusammen. Ein hoher Zuckeranteil kann zum Beispiel durch einen niedrigen Fettgehalt ausgeglichen werden. Um einen guten Nutri-Score zu erreichen, muss ein Produkt also nicht bei jedem Inhaltsstoff gut abschneiden.
Ist der Nutri-Score eine gute Lösung?
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Nährstoffe und Mineralstoffe
Welche braucht unser Körper und worin sind sie enthalten? Wir geben einen Überblick.

Vegane Ernährung und mögliche Mängel: So beugst du Nährstoffdefiziten vor
Wer auf Fleisch, Eier, Milch, Fisch oder Honig verzichtet, braucht diese Nährstoffe.

Vitamin D: So beeinflusst das Sonnenvitamin deine Gesundheit
Wirkung, Mangel, Bedarf, Überdosierung und wichtige Tipps