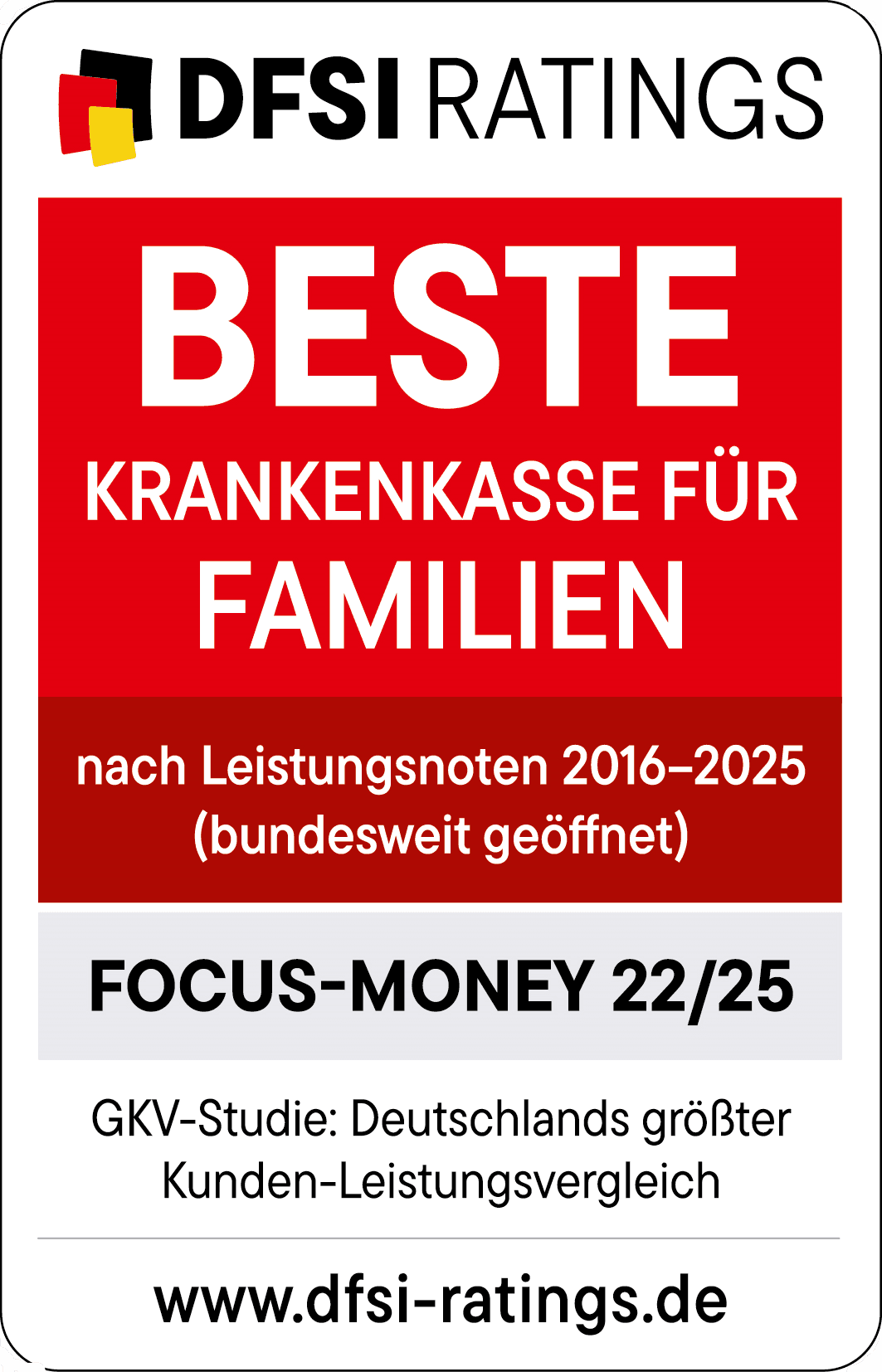DAK-Gesundheitsreport 2025: Generation Z in der Arbeitswelt

Der jährlich erscheinende DAK-Gesundheitsreport analysiert die Daten zur Arbeitsunfähigkeit aller bei der DAK-Gesundheit versicherten Berufstätigen. Er bietet damit einen verlässlichen Überblick über das Krankheitsgeschehen in der Arbeitswelt. Regelmäßig stellt die DAK-Gesundheit dar, welche Krankheiten die größte Rolle gespielt haben, und untersucht geschlechts-, alters-, branchen- und regionalspezifische Besonderheiten. Der DAK-Gesundheitsreport greift in jedem Jahr ein wechselndes Schwerpunktthema aus dem Bereich Arbeitswelt und Gesundheit auf.
Im Rahmen der Personalrekrutierung stehen Unternehmen zunehmend im Wettbewerb um die Gewinnung und Bindung junger Menschen. Die Frage, welche Wünsche und Erwartungen junge Erwerbstätige der Generation Z an die Arbeitswelt haben, wie sich ihre gesundheitliche Situation darstellt und wie sie mit Krankheiten und Fehlzeiten umgehen, ist für Akteurinnen und Akteure mit Personalverantwortung in Unternehmen häufig zentral.
Vor diesem Hintergrund widmet sich der DAK-Gesundheitsreport 2025 in seinem Schwerpunktthema der Generation Z in der Arbeitswelt.
Hintergrund
Angehörige der Generation Z werden häufig als die „Digital Natives“ beschrieben – die erste Generation, die bereits sehr früh in ihrem Leben mit digitalen und sozialen Medien in Berührung kam (Francis und Hoefl 2018). Die Generation Z umfasst die Geburtenjahrgänge von 1995 bis 2010 . Voraus ging der Generation Z die Generation Y (s.g. Millennials von ca. 1980 bis 1994) und ihr folgt die Generation Alpha (2011 bis Ende 2024) (vgl. Abbildung 1). Die Generation Z ist zum Untersuchungszeitpunkt im Jahr 2024 also zwischen 15 Jahren und 29 Jahren alt.
Der Großteil der Generation erwirbt höhere formale Ausbildungsabschlüsse, parallel ist der hiesige Arbeitsmarkt durch das Ausscheiden der Generation der Babyboomer geprägt (Hurrelmann 2018). In verschiedenen Wirtschaftszweigen sind Arbeits- oder Fachkräfte nur schwer verfügbar. Dies führt dazu, dass die Generation Z ihre Arbeitgebenden relativ frei wählen kann.
Die Generation erlebt ihre Jugend in einer Phase verschiedener Krisen, worunter ihre mentale Gesundheit und das Bedürfnis nach Sicherheit leiden (Froböse und Hoppe 2024). Anders als vorherige Generationen stellt diese Generation ihre mentale Gesundheit in den Vordergrund und geht offen mit dieser um (Jochim 2024).
Des Weiteren war die Jugendphase vieler Mitglieder der Generation Z beeinflusst durch die COVID-19-Pandemie sowie deren Schutzmaßnahmen, die nicht spurlos an der Psyche junger Menschen vorbeiging (Schlack et al. 2022).
Abbildung 1: Kohorten der Generation Z. Quelle: IGES Institut eigene Darstellung
Fragestellung
Gesundheitliche Situation
Der DAK-Gesundheitsreport untersucht vor dem Hintergrund die Frage nach der gesundheitlichen Situation der jungen Beschäftigten. Zum einen wird auf Basis der Beschäftigtenbefragung dazu der selbst eingeschätzte Gesundheitszustand der Beschäftigten unter 30 Jahren dargestellt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der psychischen Gesundheit und möglichen inner- und außerbetrieblichen Belastungsfaktoren des Krankmeldeverhaltens. Darüber hinaus wird die zeitliche Entwicklung der gesundheitlichen Situation auf Basis der Diagnosen aus der ambulanten Behandlung dargestellt. Welche Merkmale das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen der unter 30-Jährigen charakterisieren, wird auf Basis der Arbeitsunfähigkeitsdaten beschrieben.
Umgang mit Erkrankungen- und Krankmeldeverhalten
Auf Basis der Beschäftigtenbefragung wird ein differenzierter Blick auf das Krankmeldeverhalten der Beschäftigten unter 30 Jahre geworfen. Dabei befasst sich der Gesundheitsreport neben der Frage nach dem Einfluss der Covid-19 Pandemie auf das Gesundheitsverhalten junger Beschäftigter auch tiefer mit dem Krankmeldeverhalten und dem Phänomen Präsentismus.
Arbeitszufriedenheit und Erwartungen an die Arbeitswelt
Weitere Fragestellungen befassen sich mit der Zufriedenheit junger Beschäftigter mit ihrer beruflichen Tätigkeit. Dabei geht es darum darzustellen, welche Aspekte jungen Beschäftigten bei der Arbeit besonders wichtig sind und um die Frage, ob andere Einflussfaktoren als durch die Generation beeinflusste Charaktermerkmale eine Rolle spielen.
Generationenkonflikte
Einen weiteren Fokus setzt der DAK-Gesundheitsreport auf das Thema Generationenkonflikte. Dabei geht es um die Frage, inwieweit mögliche Generationenkonflikte und Zuschreibungen unter den Beschäftigten geteilt werden, welche Erfahrungen es dazu gibt und welche Auswirkungen sie auf die Beschäftigten haben. Der Report stellt die Verbreitung von Generationenkonflikten und den Einfluss auf die Beschäftigten dar.
Datenquellen und Methodik
Die Ergebnisse des Schwerpunktthemas stützen sich auf verschiedene Datenquellen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Prozessdaten der DAK-Gesundheit. Für die Analysen wurden Arbeitsunfähigkeitsdaten und die Daten aus der ambulanten Behandlung der 2,4 Mio. bei der DAK-Gesundheit versicherten Beschäftigten analysiert.
Zum anderen wurde eine standardisierte Online-Befragung von 7.068 abhängig Beschäftigten im Alter von 18 bis 65 Jahren in Deutschland durchgeführt. Die Befragung wurde im Zeitraum 31. Oktober bis zum 15. November 2024 durch die forsa Politik- und Sozialforschung GmbH als Online-Befragung realisiert.
Die Befragten sind auf Basis der Daten des Mikrozensus nach Alter, Geschlecht, Bildung und Bundesland gewichtet, sodass der Datensatz repräsentativ für die abhängig beschäftigte Bevölkerung im Alter von 18 bis 65 Jahren in Deutschland ist.
Zusätzlich wurden die Beschäftigtenbefragungen der Gesundheitsreporte 2011 (Schwerpunkt: Wie gesund sind junge Arbeitnehmer im Herbst 2010; 3.003 Befragte) (Krämer und Nolting 2011) und 2016 (Gender und Gesundheit, Befragung im Herbst 2015; 5.175 Befragte) (Marschall et al. 2016) für den vorliegenden Report herangezogen.
Abbildung 2: Datenquellen des DAK-Gesundheitsreports 2025. Quelle: IGES Institut eigene Darstellung
Anders als bei der klassischen Querschnittsbefragung (einmalige Befragung) werden hierbei verschiedene Stichproben von Beschäftigten zu unterschiedlichen Zeitpunkten miteinander verglichen, wobei es sich nicht um dieselben Beschäftigten zu unterschiedlichen Zeitpunkten handelt. Mit Hilfe dieser drei Querschnittsbefragungen von Beschäftigten wird versucht neben Alterseffekten auch Rückschlüsse auf Generationsunterschiede abzuleiten bzw. Veränderungen unter den Beschäftigten über die Zeit, beispielsweise im Verhalten oder bei Einstellungen.
Einschränkend ist bei der Interpretation der Ergebnisse zum Krankmeldeverhalten dabei zu beachten, dass die gewählte Methodik zu diesem Phänomen erfolgte, um den Einfluss auf die Entwicklung des Krankenstands zu untersuchen. Sie erlaubt eine Einschätzung über die ungefähre Größenordnung, jedoch keine abschließende Beurteilung zur gesundheitlichen Legitimation des Krankmeldeverhaltens: Eine Krankmeldung unterliegt immer Interpretationsspielräumen. Die Befragung enthält zudem keine konkrete Quantifizierung von Häufigkeiten oder Fehltagen. Der Gesundheitsreport soll Hinweise für eventuelle Beratungsbedarfe im Betrieblichen Gesundheitsmanagement bieten und weitergehenden Forschungsbedarf aufzeigen.
Eine weitere Datenquelle stellt eine halbstandardisierte Befragung von Expertinnen und Experten dar. Der Pool der Befragten umfasst dabei zum einen Personen aus der wissenschaftlichen Praxis und zum anderen betriebliche Fachleute.
Ergebnisse des Gesundheitsreports
Gesundheitliche Situation
Die Gruppe der Beschäftigten bis 29 Jahre hat 2024 mit 4,7 Prozent einen unterdurchschnittlichen Krankenstand. Im Durchschnitt über alle Beschäftigten liegt der Krankenstand 2024 bei 5,4 Prozent. Die AU-Daten für jüngere Versicherte zeigen, dass es sich hierbei häufig um kurze Krankmeldungen und Akuterkrankungen handelt. Beschäftigte unter 30 Jahre sind zwar überdurchschnittlich häufig krankgeschrieben, aber die durchschnittliche Krankschreibungsdauer ist regelhaft sehr kurz und beträgt 2024 nur 5,9 Tage (Durchschnitt über alle Altersgruppen: 9,7 Tage).
Abbildung 3 zeigt die Fehlzeiten der Beschäftigten unter 30 Jahre nach Erkrankungsgruppen im Vergleich zu den Fehlzeiten aller Beschäftigten im Durchschnitt. Dabei wird deutlich, dass sich in einigen Erkrankungsgruppen wie z.B. bei den Atemwegserkrankungen mehr Fehlzeiten zeigen als im Durchschnitt, bei anderen deutlich weniger, z.B. bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen. Insgesamt ergibt sich dadurch eine andere Reihenfolge im Fehlzeitenspektrum.
Abbildung 3: Fehlzeiten (AU-Tage je 100 Versichertenjahre) nach Erkrankungsgruppen. Quelle: AU-Daten der DAK-Gesundheit 2024
Atemwegserkrankungen sind mit Abstand die häufigste Ursache von Krankmeldungen bei Beschäftigten bis 29 Jahren. In der ambulanten Versorgung stellen Atemwegserkrankungen bei den jungen männlichen Beschäftigten ebenfalls die häufigste Diagnose dar, 65 Prozent der männlichen Beschäftigten bis 19 Jahren waren mit dieser Diagnose 2023 in ärztlicher Behandlung und 69 Prozent der weiblichen Beschäftigten in dieser Altersgruppe.
In der Befragung schätzen junge Beschäftigte ihren Gesundheitszustand altersgemäß und damit im Vergleich zu den älteren Beschäftigten am besten ein.
Allerdings zeigt sich schon bei jungen Beschäftigten auch eine hohe Belastung durch chronische Erkrankungen. So geben rund 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und über 25 Prozent der 25- bis 29-Jährigen in der Beschäftigtenbefragung an, unter einer oder mehreren chronischen körperlichen Erkrankungen zu leiden. Unter einer chronischen psychischen Erkrankung zu leiden, geben Beschäftigte in diesen beiden Altersgruppen zu 18 bzw. 17 Prozent an.
Psychische Erkrankungen stellen darüber hinaus mit einem Anteil von rund 14 Prozent an den Fehltagen die zweit wichtigste Erkrankungsgruppe im Fehlzeitengeschehen bei Beschäftigten bis 29 Jahren dar. Bei knapp einem Drittel (31 Prozent) der weiblichen Beschäftigten bis 19 Jahre und bei einem Fünftel der männlichen Beschäftigten in dieser Altersgruppe wurde 2023 eine ambulante Behandlungsdiagnose aus dem Kapitel der psychischen Erkrankungen vergeben. Im Vordergrund stehen hierbei Depressionen, Angststörungen oder Belastungsstörungen.
Eine depressive Symptomatik ist bei den jüngeren Beschäftigten unter 30 verbreiteter als bei Beschäftigten ab 30. Im Hinblick auf Belastungen während der Arbeit, empfindet weniger als ein Fünftel der Beschäftigten bis 29 Jahren Arbeit als sehr belastend. Mit zunehmendem Alter steigt die Arbeitsbelastung. Gegenüber 2010 nimmt der Anteil stark durch die Arbeit Belasteter unter den 25- bis 29-Jährigen aber ab.
Gesundheits- und Krankmeldeverhalten
In Folge der COVID-19-Pandemie sind besonders Beschäftigte unter 30 Jahren sensibilisiert im Umgang mit Infekten: Über die Hälfte ist vorsichtiger im Umgang mit Infekten und gut ein Viertel lässt sich mit Erkältungssymptomen eher krankschreiben (vgl. Abbildung 4). Die Befragung zeigt weiter, dass insbesondere Beschäftigte unter 30 Jahren auch seltener als 2015 angeben, mit geringfügigen Beschwerden zu arbeiten und nicht zuhause zu bleiben. Allerdings zeigt sich bei allen Beschäftigten unter 50 Jahren ein leichter Rückgang in diesem Punkt, 2015 lagen die Anteile je nach Altersgruppe noch bei über 90 Prozent und 2024 noch bei knapp unter 90 Prozent (ohne Abbildung). Zudem geben jüngere Beschäftigte 2024 häufiger an sich krankzumelden, um ihre Erkrankung nicht weiter zu verschlimmern, als die Vergleichsgruppe 2015.
Abbildung 4: Umgang mit Infekten und Erkältungssymptomen seit der Corona-Pandemie. Quelle: Beschäftigtenbefragung 2024 (n=6.966 und 6.869)
Die jüngeren Beschäftigten, insbesondere die Generation Z, zeigen ein stärkeres Bewusstsein für ihre physische und psychische Gesundheit. Im Gegensatz zu früheren Generationen, die oft mehr Gewicht auf Arbeitsmoral und Durchhaltevermögen legten, priorisiert die Generation Z ihre Gesundheit und sucht aktiv nach Möglichkeiten, sowohl ihre mentale als auch physische Gesundheit zu unterstützen. Sie sind proaktiver in der Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten und in der Nutzung von präventiven Maßnahmen, um langfristige Gesundheitsprobleme zu vermeiden.
Dr. Anders Parment, Stockholm Business School
Auch wenn Präsentismus bei den Beschäftigten unter 30 Jahren weniger verbreitet ist als bei den Beschäftigten mittleren Alters (30 bis 49 Jahre), geben insgesamt rund 65 Prozent der jungen Beschäftigten an, in den letzten zwölf Monaten krank gearbeitet zu haben. Im Vergleich zu 2015 ist Präsentismus bei den Beschäftigten unter 30 Jahren rückläufig. Auffällig ist, dass 44 Prozent der jungen Beschäftigten, die angeben, krank gearbeitet zu haben, Nachteile durch zu häufige Krankmeldungen befürchten. Bei den Beschäftigten ab 50 Jahren geben dies nur noch 18 Prozent als Grund an. Keine Veränderung zeigt sich in dem am häufigsten genannten Punkt für Präsentismus: Zu beiden Befragungszeitpunkten 2015 und 2024 geben Beschäftigte unter 30 Jahren an, dass sie krank gearbeitet haben, weil sie die Kolleginnen und Kollegen nicht hängen lassen wollten (79 Prozent derjenigen, die krank gearbeitet haben).
Beschäftigte unter 30 Jahren scheinen sich etwas häufiger ohne triftigen Grund krankzumelden als Beschäftigte ab 30 Jahre, dabei korrelieren dieser missbräuchliche Umgang mit Krankmeldungen und das Alter nur schwach miteinander und dieses Phänomen ist kein Massenphänomen bei Beschäftigten unter 30 Jahren.
Die Ergebnisse zur Frage des sogenannten ‚Blaumachens‘ sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Wenngleich die Selbsteinschätzung bei Umfragen ein interessantes Meinungsbild erzeugt, müssen Faktoren wie soziale Erwünschtheit, Fehlertoleranzen und unterschiedliche Interpretationen der Frage beachtet werden. So ist es denkbar, dass insbesondere jüngere Beschäftigte unter ‚ohne triftigen Grund fehlen‘ nicht zwingend einen leichtfertigen Fehlgebrauch verstehen, sondern eine bewusstere Abgrenzung gegenüber Überlastung oder ein legitimes Bedürfnis nach kurzfristiger Erholung – also Formen von Selbstschutz, die mit einem veränderten Verständnis von Gesundheit und Belastbarkeit einhergehen. Aus meiner Sicht bedarf es hier einer kontextualisierenden Betrachtung – etwa im Rahmen qualitativer Erhebungen –, um wirklich zu verstehen, welche Haltungen, Normen oder konkreten Arbeitsbedingungen hinter diesen Antworten stehen.
Dr. Kilian Hampel, Senior Research Fellow am Future of Work Lab der Universität Konstanz, Mitautor der Trendstudie „Jugend in Deutschland“
Vgl. hierzu auch die Hinweise zur Interpretation im Abschnitt Datenquellen und Methodik.
Allgemein sind junge Beschäftigte stärker als die Älteren im Hinblick auf ihre persönliche Zukunft belastet. Durch die Informationsflut der Medien fühlen sich jüngere Beschäftigte unter 30 Jahren seltener belastet als Ältere ab 50.
Arbeitszufriedenheit und Erwartungen an die Arbeitswelt
Die Befragung zeigt insgesamt eine hohe Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrer Arbeit insgesamt. 86 Prozent aller befragten Beschäftigten geben an mit ihrer Arbeit „voll und ganz“ (28 Prozent) oder „eher“ (58 Prozent) zufrieden zu sein. Auch unter den Beschäftigten unter 30 stellt sich die Situation so dar: 26 Prozent sind „voll und ganz“ und weitere 58 Prozent „eher“ zufrieden mit ihrer Arbeit insgesamt.
Die Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der eigenen Tätigkeit hat in den letzten 14 Jahren bei den Beschäftigten unter 30 Jahren deutlich abgenommen. „Voll und ganz zufrieden“ mit der Arbeit insgesamt waren den Befragungsergebnissen zufolge in 2010 noch 43 Prozent der Beschäftigten unter 30 Jahren. Allgemein sind die Unterschiede in den Bewertungen hinsichtlich verschiedener Tätigkeitsaspekte zwischen den Altersgruppen nur schwach ausgeprägt.
Auf die Frage nach wichtigen Aspekten der Arbeit bewerten die jüngeren Beschäftigten bis unter 30 Jahren ein gutes Arbeitsklima am häufigsten als „sehr wichtig“ (vgl. Abbildung 5), an zweiter Stelle folgt eine gute Bezahlung (62 Prozent „sehr wichtig“).
Insgesamt zeigen die Befragungsergebnisse, dass über alle Altersgruppen hinweg ein breiter Konsens über die Wichtigkeit bestimmter Arbeitsbedingungen besteht. Dies gilt auch für Aspekte, die man zunächst vor allem mit den Ansprüchen junger Beschäftigter an ihre Arbeit verbindet, wie z.B. die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Dieser Aspekt ist 61 Prozent der Beschäftigten unter 30 Jahren „sehr wichtig“, aber auch 55 Prozent aller Beschäftigten bewerten diesen Aspekt als „sehr wichtig“. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes und eine unterstützende Führungskraft sind ebenfalls Aspekte, die bei Beschäftigten unter 30 Jahren zu den Top 6 Aspekten unter den als „sehr wichtig“ bewerteten Aspekten zählen.
Abbildung 5: Top 6 der sehr wichtigen Aspekte bei der Arbeit der Beschäftigten unter 30 Jahre. Quelle: Beschäftigtenbefragung 2024 (n= 6.955-7.013)
Bei der Bewertung der wichtigen Aspekte von Arbeit zeigt sich darüber hinaus, dass verschiedene Lebensphasen oder -ereignisse die Bewertung stark beeinflussen. Für Beschäftigte mit kurzer Betriebszugehörigkeit (seit 2022 oder später) ist es wichtiger (57 Prozent) als für Beschäftigte mit längerer Betriebszugehörigkeit (50 Prozent), dass eine gute Einarbeitung bei Neueinstieg existiert. In diesem Punkt gibt es kaum Unterschiede zwischen den Beschäftigten unter 30 Jahren und über 50 Jahren (vgl. Abbildung 6). Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei der Bewertung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben je nachdem, ob Kinder bis zwölf Jahre im Haushalt der Befragten leben oder nicht.
Abbildung 6: Bewertung des Aspekts „Einarbeitung“ nach Dauer der Betriebszugehörigkeit. Quelle: Beschäftigtenbefragung 2024 (n= 6.932)
Viele Unternehmen wollen verstehen, wie die Generation Z tickt, um dann passgenaue Angebote zu entwickeln. Doch solche spezifischen Angebote machen wenig Sinn. Zielführender kann es sein, für Beschäftigte in unterschiedlichen Lebensphasen wie dem Berufseinstieg oder der Lebensmitte spezifische Angebote zu machen. Die Lebensphasen gehen mit unterschiedlichen Bedarfen an Flexibilität einher, beispielsweise der Sorgearbeit für Kinder oder Eltern. Ein lebensphasenorientiertes Personalmanagement ist der Schlüssel, um auf die unterschiedlichen Bedarfe der Beschäftigten einzugehen.
Prof. Dr. Friedericke Hardering, Professorin für Zukunft der Arbeit und Digitalisierung, Fachbereich Sozialwesen / Department of Social Work an der FH Münster
Generationenkonflikte
Generationenkonflikte treten am häufigsten in eher älteren Teams auf. Dort sind mit 44 Prozent am häufigsten jüngere Beschäftigte betroffen, die Generationenkonflikte hin und wieder bzw. häufig oder sehr häufig erleben. In einem eher jungen Team berichten Beschäftigte ab 50 Jahren zu höheren Anteilen (28 Prozent) von Generationenkonflikten, als die jüngeren Beschäftigten. Insgesamt erleben 28 Prozent der unter 30 Jährigen zumindest hin und wieder Generationenkonflikte und damit häufiger als ältere Beschäftigte (vgl. Abbildung 7).
Abbildung 7: Erlebte Generationenkonflikte. Quelle: Beschäftigtenbefragung 2024 (n= 6.873)
Diese Generationenkonflikte belasten am stärksten Beschäftigte unter 30 Jahren, die sich dadurch falsch beurteilt fühlen (vgl. Abbildung 8). Zuschreibungen zu jüngeren Beschäftigten werden häufig geteilt, bei den älteren Beschäftigten ist dies weniger stark zu erkennen. Mit einem Anteil von 30 Prozent sind Generationenkonflikte im Gesundheitswesen und in der Branche Erziehung und Unterricht am weitesten verbreitet.
Da Deutschland – und in gewissem Maße auch andere EU-Länder – vor großen Herausforderungen in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit steht, ist es dringend notwendig, dass Unternehmen eine konstruktive Haltung gegenüber jungen Mitarbeitern, wie der Generation Z, einnehmen. Andernfalls besteht ein erhöhtes Risiko für Brain-Drain und mangelnde Motivation unter jungen Mitarbeitern, was die wirtschaftlichen Probleme weiter verschärfen könnte.
Dr. Anders Parment, Stockholm Business School
Abbildung 8: Belastung durch Generationenkonflikte. Quelle: Beschäftigtenbefragung 2024 (n= 1.589)
Eine vertiefende Analyse zeigt abschließend, dass ein Zusammenhang zwischen dem Erleben von Generationenkonflikten und der Arbeitszufriedenheit besteht. So geben 31 Prozent der Beschäftigten ohne Generationenkonflikte an, mit der Arbeit insgesamt „voll und ganz“ zufrieden zu sein, aber nur 20 Prozent der Beschäftigten mit Generationenkonflikten im Team sind „voll und ganz“ zufrieden mit ihrer Arbeit.
In Unternehmen gibt es oft Spannungen rund um das Thema Generationen. Diese entstehen jedoch meist durch Klischees. Studien zeigen, dass stereotype Vorstellungen über verschiedene Generationen und ihre Arbeitseinstellungen weit verbreitet sind. Häufig werden anderen Generationen pauschal negative Eigenschaften zugeschrieben. Das kann Vertrauen zerstören. Es erschwert auch die Zusammenarbeit. Deshalb sollten Organisationen in Weiterbildungen oder Workshops über Generationenmythen aufklären. Denn die Unterschiede in den Arbeitseinstellungen sind oft geringer, als viele denken. Tatsächlich überwiegen die Gemeinsamkeiten. Mit diesem Wissen lassen sich Konflikte vermeiden und der Zusammenhalt im Team fördern.
Prof. Dr. Friedericke Hardering, Professorin für Zukunft der Arbeit und Digitalisierung, Fachbereich Sozialwesen / Department of Social Work an der FH Münster
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass Beschäftigte der Generation Z nach der Pandemie vorsichtiger im Umgang mit Infektionen sind und sich bei Erkältungssymptomen eher krankschreiben lassen. Die genannten Gründe für Krankmeldungen bestätigen diese Entwicklung hin zu einem sensibleren Umgang: Mehr Beschäftigte unter 30 Jahren melden sich krank, um zu verhindern, dass sich ihre Erkrankung verschlimmert. Die Gründe für Präsentismus zeigen aber auch, dass junge Beschäftigte inzwischen mehr Angst vor Benachteiligung durch “zu häufiges Krankmelden” haben.
Hinsichtlich der Präferenzen im Job weisen die Ergebnisse darauf hin, dass diese deutlich von den unterschiedlichen Lebensphasen geprägt sind. Insgesamt zeigen sich nur geringe Unterschiede zwischen den Altersgruppen.
Generationenkonflikte sind insbesondere für Beschäftigte der Generation Z problematisch. In ihrer Altersgruppe sind sie am weitesten verbreitet und stellen eine hohe Belastung dar. Am weitesten verbreitet sind Generationenkonflikte im Gesundheitswesen und im Erziehungsbereich. Insgesamt bedarf es einer kritischen betrieblichen Auseinandersetzung mit Stereotypen sowie individueller, innerbetrieblicher Konzepte für einen generationengerechten Umgang miteinander.
Auf ein Wort