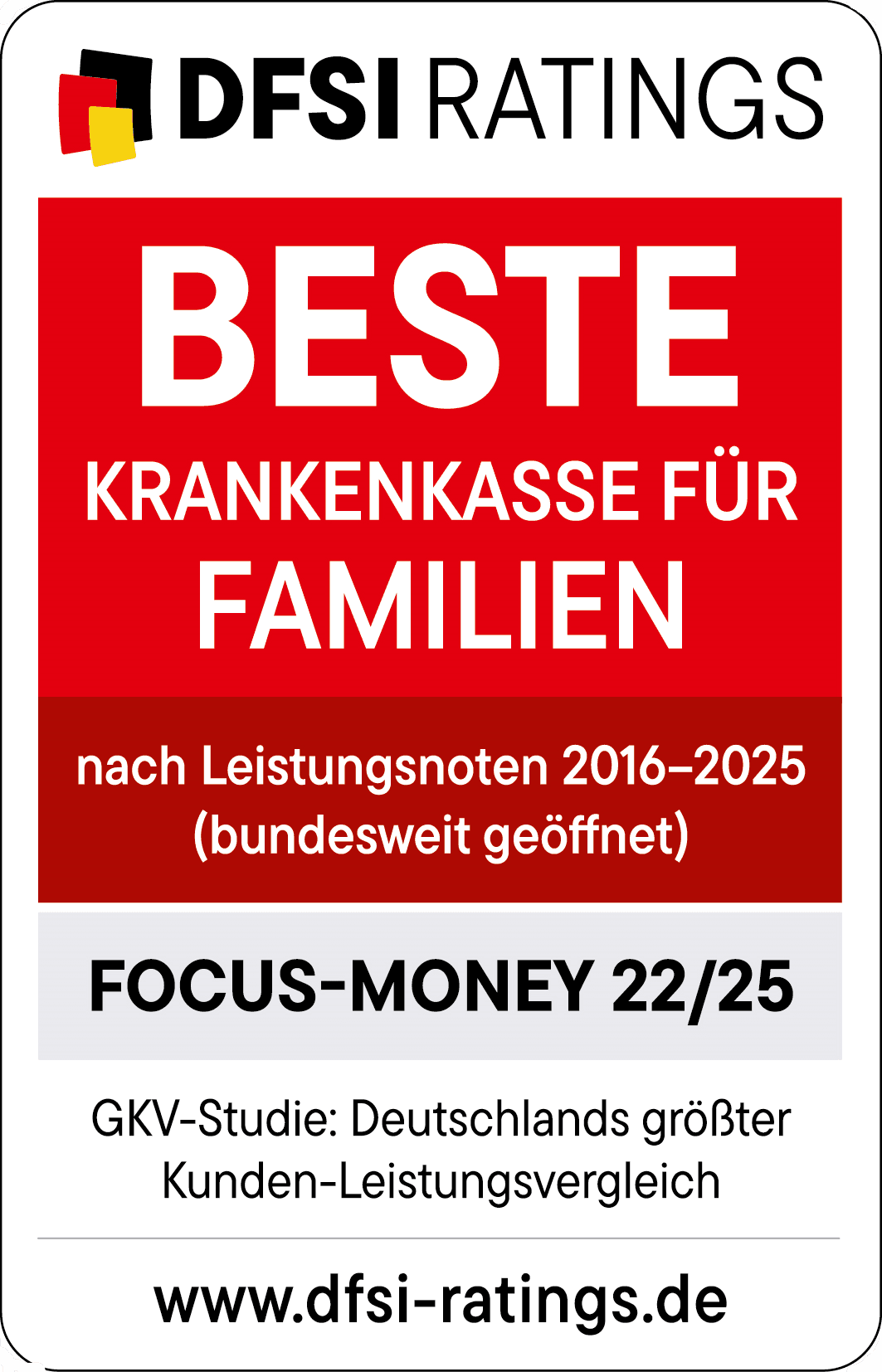DAK-Whitepaper Wechseljahre 2025: Eine Analyse der Symptomatik, Informationslücken und beruflichen Auswirkungen

Die Wechseljahre stellen für einen erheblichen Teil der deutschen Erwerbsbevölkerung eine komplexe Herausforderung dar, die bisher in der systematischen gesundheitlichen und betrieblichen Aufmerksamkeit unterrepräsentiert ist. Mit über 43 Millionen Frauen in Deutschland und etwa 13 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter zwischen 40 und 62 Jahren handelt es sich um ein demographisch bedeutsames Phänomen. Allein bei der DAK-Gesundheit sind über 800.000 Frauen dieser Altersgruppe versichert. Trotz dieser quantitativen Relevanz bleibt die Phase der Menopause häufig ein vernachlässigtes Thema im betrieblichen Gesundheitsmanagement, in der ärztlichen Versorgung und in der öffentlichen Diskussion. Eine bundesweite Befragung durch die DAK-Gesundheit hat diesen Zustand dokumentiert und bietet nun eine datengestützte Grundlage für die Entwicklung gezielter Unterstützungsmaßnahmen in betrieblichen, gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Kontexten.
Multidimensionale Symptomatik und emotionale Belastung
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass die Wechseljahre für viele Frauen eine multidimensionale Herausforderung darstellen, die körperliche, emotionale und soziale Dimensionen umfasst. Die Beschwerdespektrum ist vielfältig und reicht von klassischen vasomotorischen Symptomen wie Hitzewallungen und Schlafstörungen bis zu psychischen und sozialen Beeinträchtigungen wie emotionaler Erschöpfung, Stimmungsschwankungen sowie Problemen in partnerschaftlichen und beruflichen Beziehungen. Eine bedeutsame Befundung zeigt, dass es eine Dosisabhängigkeit zwischen der Symptombelastung und der Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands gibt: Je mehr Beschwerden eine Frau erfährt, desto ungünstiger wird der subjektive Gesundheitszustand bewertet. Besonders hervorzuheben ist, dass für nahezu zwei von fünf Frauen die Wechseljahre einen negativen emotionalen Prozess darstellen, was auf die erhebliche psychische Komponente dieser Lebensphase hinweist.
Tabuisierung und mangelnde medizinische Anerkennung
Ein kritischer Fund betrifft die andauernde Tabuisierung der Wechseljahre im gesellschaftlichen und beruflichen Kontext. Obwohl nur jede vierte Frau im privaten Umfeld nicht über ihre Symptome spricht, empfindet es beinahe jede zweite Frau als belastend, das Thema mit ihrem Arbeitgeber zu diskutieren. Diese Asymmetrie verdeutlicht die spezifische Stigmatisierung in professionellen Kontexten. Hinzu kommt ein fundamentales Vertrauensdefizit gegenüber dem Gesundheitssystem: Nur etwas mehr als ein Drittel der Frauen hat das Gefühl, dass Ärztinnen und Ärzte die Wechseljahre als ernst zu nehmendes gesundheitliches Phänomen einstufen. Diese wahrgenommene mangelnde Anerkennung führt dazu, dass ein großer Teil der betroffenen Frauen mit ihren Sorgen und Beschwerden ohne professionelle Unterstützung bleibt und sich stattdessen an weniger verlässliche Informationsquellen wendet.
Zitat Dr. Ute Wiedemann
Wissensdefizite trotz Selbsteinschätzung
Eine paradoxe Befundung zeigt sich bezüglich des Wissensstands: Mehr als die Hälfte der Frauen glaubt, gut über die Wechseljahre informiert zu sein, doch bei zentralen Faktoren wie dem Beginn, der Dauer oder den biologischen Ursachen zeigen sich erhebliche Lücken. Die primären Informationsquellen sind bemerkenswert: Seriöse Institutionen wie Frauenärztinnen und Frauenärzte, Hausärztinnen und Hausärzte sowie Krankenkassen leisten kaum eine proaktive Informationsbereitstellung. Stattdessen beziehen viele Frauen ihre Informationen aus Zeitschriften, sozialen Medien oder ihrem privaten Umfeld. Diese Situation weist auf einen markanten Mismatch zwischen dem Bedarf an verlässlichen, wissenschaftlich fundierten Informationen und dem tatsächlichen Informationsangebot etablierter Gesundheitsinstitutionen hin.
Berufliche Beeinträchtigungen und unzureichende Unterstützung
Die beruflichen Auswirkungen der Wechseljahre sind erheblich: Etwa jede dritte Frau erleben teilweise starke berufliche Belastungen, die sich in eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, erhöhten Fehlzeiten und Arbeitsausfällen manifestieren. Gegenwärtig liegt die Verantwortung für die Bewältigung dieser Phase primär bei den Frauen selbst, die durch Homeoffice, flexible Arbeitszeiten oder reduzierte Stunden ihre Situation zu kompensieren versuchen. Die Arbeitgeber hingegen bieten selten spezifische Unterstützungsmaßnahmen an; existierende Angebote beschränken sich häufig auf allgemeine Regelungen wie Arbeitszeitflexibilisierung oder Entspannungskurse. Das zentrale Problem besteht darin, dass solche Maßnahmen nicht symptomorientiert auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen in den Wechseljahren ausgerichtet sind. Sinnvolle Interventionen würden beispielsweise eine bessere Temperaturregelung der Arbeitsumgebung für Frauen mit Hitzewallungen, individuelle Klimatisierungsmöglichkeiten oder atmungsaktive Arbeitskleidung umfassen. Gleichzeitig sind soziale Interventionen – wie moderierte Gesprächsforen, Workshops und die Sensibilisierung von Führungskräften – notwendig, um die gesellschaftliche Tabuisierung abzubauen.
Differenzierung nach Alter und Unternehmensstruktur
Die Altersgruppe der 49- bis 55-Jährigen ist am stärksten betroffen: Mehr als jede Dritte dieser Gruppe berichtet von beruflicher Beeinträchtigung, und bei denjenigen, die eine Belastung erleben, fällt diese bei über der Hälfte stark aus. Jüngere Frauen zwischen 40 und 48 Jahren zeigen mit 23 % eine niedrigere Prävalenz beruflicher Beeinträchtigung. Die Unternehmensstruktur spielt ebenfalls eine Rolle: Frauen in Betrieben mit über 500 Mitarbeitern berichten häufiger von Beeinträchtigungen (35 %) als in Kleinstunternehmen (27 %); sie nennen dabei vermehrt Überforderung, Fehlzeiten und soziale Unsicherheit. Interessanterweise ergreifen Frauen in Kleinstunternehmen bei Beschwerden seltener Eigenmaßnahmen (54 %) als in größeren Organisationen (69 %).
Fazit
Die Studie dokumentiert ein systematisches Versorgungsdefizit im Umgang mit den Wechseljahren. Während die physiologische und psychosoziale Belastung für viele Frauen erheblich ist, bleiben professionelle Unterstützungsstrukturen unterentwickelt. Gezielt entwickelte, symptomorientierte Maßnahmen in Betrieben könnten die Leistungsfähigkeit von Frauen bewahren und ein Gefühl von Anerkennung und Unterstützung fördern.