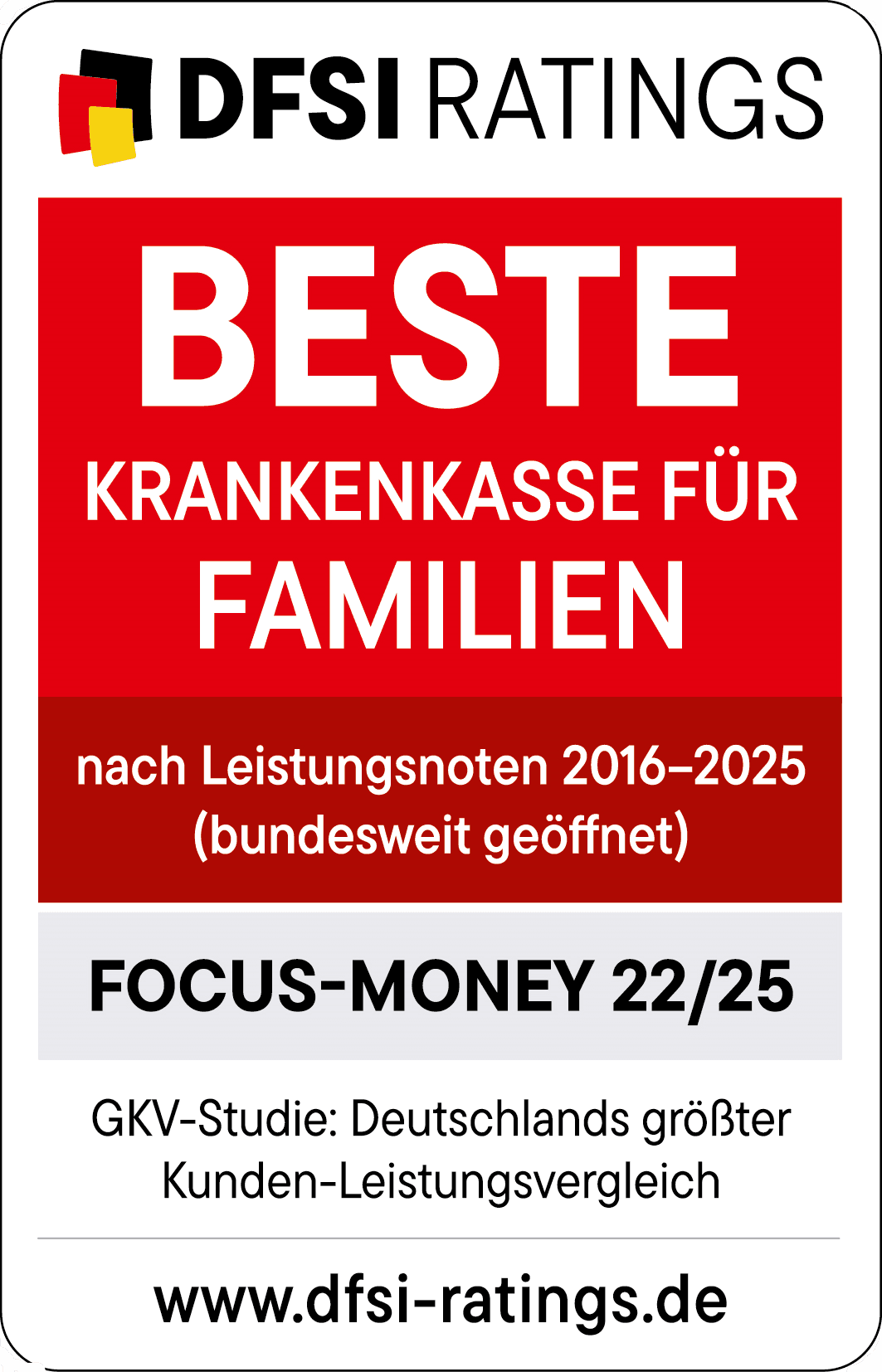CTG: Kardiotokografie in der Schwangerschaft

Was wird beim CTG gemacht?
Während der Schwangerschaft und der Geburt ist das CTG ein wichtiges Instrument, um Informationen über die Gesundheit des ungeborenen Kindes zu erhalten. Dabei überprüft das CTG (Kardiotokografie, auf Deutsch: Herzton-Wehenschreibung) den Herzschlag des Kindes und die Intensität der Wehentätigkeit.
So funktioniert es: Für die Untersuchung wird ein Gurt um den Bauch der werdenden Mutter gelegt. Dieser Gurt enthält zwei Sensoren. Der eine Sensor (Dopplerschallkopf), übersetzt die Signale in die kindliche Herzfrequenz, der andere Sensor ist ein Druckaufnehmer, der Spannungsänderungen registriert (Wehentätigkeit).
CTG-Untersuchung – Warum wird das CTG gemacht?
Ab wann wird ein CTG in der Schwangerschaft eingesetzt?
Ein CTG wird vor allem im letzten Schwangerschaftsdrittel (etwa ab der 27. Schwangerschaftswoche) und unter der Geburt geschrieben. Frühere Einsätze dieser Technologie werden derzeit erforscht.
DAK MamaPLUS
Unser Leistungspaket für Schwangere mit exklusiven Zusatzleistungen
Anders sieht es natürlich bei Schwangerschaften mit besonderem Überwachungsbedarf aus, zum Beispiel bei Erkrankungen wie Schwangerschaftsdiabetes, erhöhtem Blutdruck oder Präeklampsie. Hier ist ein CTG nach wie vor unverzichtbar. Ein CTG wird außerdem bei den folgenden Indikationen geschrieben:
- Drohende Frühgeburt in der 26. und 27. Schwangerschaftswoche
- Auffällige Herztöne ab der 28. Woche oder Verdacht auf vorzeitige Wehentätigkeit
Gründe für eine Wiederholung des CTGs sind unter anderem:
- Auffälligkeiten im ersten CTG
- Anhaltend hohe Herzfrequenz des Babys (über 160 Schläge pro Minute)
- Niedrige Herzfrequenz des Babys (unter 100 Schläge pro Minute)
- Verdacht auf vorzeitige Wehen
- Mehrlingsschwangerschaft
- Tod des Kindes in einer früheren Schwangerschaft
- Verdacht auf eine unzureichende Funktion der Plazenta (Plazentainsuffizienz)
- Verdacht auf Übertragung (überschrittener Geburtstermin)
- Blutungen der Gebärmutter
- Einsatz von Medikamenten zur Wehenhemmung
Was zeigt das CTG an?
Beim CTG werden zwei Kurven ausgedruckt. Die obere zeigt die Herzfrequenz des Kindes, die untere die Wehentätigkeit der Mutter.
Die Auswertung dieser Herztonwehenschreibung erfordert Erfahrung. Der sogenannte FIGO-Score wird herangezogen, um die Daten systematisch zu analysieren. Betrachtet wird dabei immer der gesamte Messzeitraum. Mehrere CTGs in Abständen von Stunden oder Tagen sind oft nötig, um ein verlässliches Ergebnis zu erhalten.
Das liegt auch daran, dass sich jede Bewegung des Kindes auf der Herzfrequenzkurve zeigt. Auch eine Wehe oder die Körperhaltung der Mutter kann die Herzschlagfrequenz kurzfristig ändern, ohne dass Anlass zur Besorgnis besteht. Auffällige Ausschläge sind beim CTG also nicht ungewöhnlich; insgesamt sollte jedoch eine gleichmäßige Herzfrequenz von 110 bis 160 Schlägen pro Minute zu erkennen sein.
CTG-Auswertung – Was sagt der Wehenschreiber?
Der Wehenschreiber ist die untere Kurve im CTG und zeigt, ob die Wehen bereits regelmäßig und stark genug für den Geburtsprozess sind. Auf dem CTG sind Wehen als wellenartige Ausschläge sichtbar. Zu sehen ist die „Baseline“, die den Ruhezustand der Gebärmutter markiert, sowie die Ausschläge durch die Wehentätigkeit. Je höher die Ausschläge, desto stärker die Kontraktionen. Höhe und Häufigkeit der Ausschläge geben Hinweise darauf, ob eventuell bereits Maßnahmen nötig sind, um die Geburt zu unterstützen.
Was ist der Toco-Wert beim CTG?
Die Wehenaktivität wird beim CTG als „Toco-Wert“ gemessen. Dieser beschreibt die Druckveränderungen auf der Bauchdecke, die Rückschlüsse auf Intensität und Dauer der Gebärmuttermuskulatur erlauben. Ein hoher Toco-Wert steht für Wehenaktivität, während ein niedriger Wert bedeutet, dass die Gebärmutter gerade entspannt ist.
CTG direkt vor und während der Geburt
Gesunde Schwangerschaft
Diese kostenlosen Vorsorgeuntersuchungen solltest du in Anspruch nehmen
Besonders häufig wird das CTG direkt vor und während der Geburt eingesetzt. Wie oft und lange es nötig ist, entscheiden die Geburtshelfer. Falls ein Dauer-CTG erforderlich ist, gibt es inzwischen kabellose Geräte, die es der Gebärenden erlauben, sich frei zu bewegen. Sollte eine noch intensivere Überwachung nötig sein, existiert sogar die Möglichkeit einer internen CTG-Überwachung. Hierbei wird ein Sensor durch den geöffneten Muttermund in die Gebärmutter eingeführt und am Kopf des Kindes befestigt. Nötig ist das aber nur in ganz wenigen Fällen.
Wie lange dauert ein CTG?
Ein CTG dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Während der Geburt kann es auch über mehrere Stunden eingesetzt werden.
Ist CTG stressig für das Baby?
Das CTG ist eine nichtinvasive, sichere Untersuchungsmethode. Die Ultraschallwellen sind für das Kind ähnlich (wenig) spürbar wie bei einer bildgebenden Ultraschalluntersuchung. Allerdings kann sich der Stress der Mutter auf das Kind übertragen, und eine CTG-Untersuchung kann für werdende Eltern herausfordernd sein, vor allem, wenn Auffälligkeiten Grund zur Sorge geben. Entspannungsübungen und Selbstfürsorge können helfen, die Ruhe zu bewahren. Das ist aus vielen Gründen wichtig, während des CTGs hilft es dabei, verlässliche Messungen zu erhalten.
Wird das CTG von der Krankenkasse übernommen?
Als medizinisch notwendige Diagnosemaßnahme übernehmen wir die Kosten für das CTG.
Fachbereich der DAK-Gesundheit