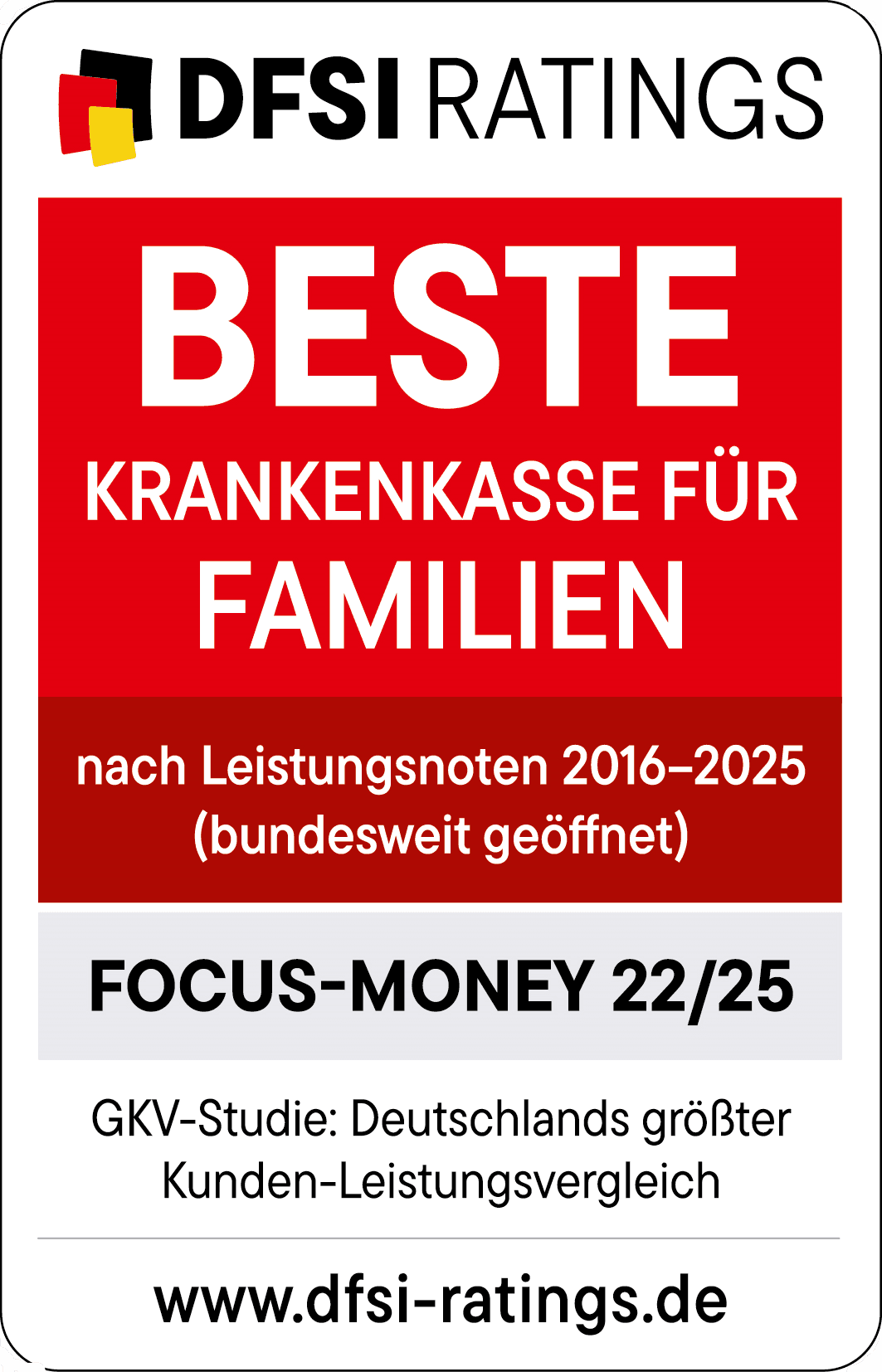Beitrag-Pflegeversicherung: Digitales Nachweisverfahren für Kinder / Elterneigenschaft
Der allgemeine Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt 3,6. Beschäftigte teilen sich den Beitrag mit ihrem Arbeitgeber. Jeder zahlt grundsätzlich 1,8 Prozent. Der Beitrag wird vom Bruttogehalt abgezogen.
Für Personen mit mehr als einem Kind verringert sich der Beitragssatz. Die Abschläge betragen für das zweite bis fünfte Kind jeweils 0,25 Prozentpunkte (maximal 1 Prozentpunkt). Berücksichtigt werden Kinder bis zum Ablauf des Monats, in dem sie 25 Jahre alt werden oder 25 Jahre alt geworden wären. Zu den Kindern zählen leibliche Kinder, Pflegekinder, Adoptivkinder und Stiefkinder.
Lesen Sie hier Informationen zum digitalen Nachweisverfahren der Kinder und den Ausnahmen zu steuerlich nicht erfassten Kindern.
Vereinfachtes Nachweisverfahren der Elterneigenschaft bis 30.6.2025
Für die Zeit vom 1.7.2023 bis zum 30.6.2025 galt ein vereinfachtes Verfahren zum Nachweis der Kinder (Elterneigenschaft). Es wurden lediglich Angaben zu den Kindern benötigt. Weitere Nachweise, wie zum Beispiel eine Geburtsurkunde, waren nicht notwendig.
Digitales Nachweisverfahren ab 1.7.2025
Seit dem 1.7.2025 gilt für die Berechnung der Beiträge verpflichtend ein maschinelles Verfahren, mit dem die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder übermittelt werden. Geregelt ist dies in § 55a SGB XI.
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ist in dem elektronischen Verfahren die zentrale Datenquelle und hält die Daten der Meldebehörden und Finanzämter bereit. Arbeitgeber und Pflegekassen rufen die Angaben zur Elterneigenschaft dort digital ab.
Änderungen der sogenannten Elterneigenschaft oder der Anzahl der zu berücksichtigungsfähigen Kinder werden den beteiligten Stellen über das neue digitale Verfahren proaktiv mitgeteilt. Dies ist wichtig, um die korrekten Pflegeversicherungsbeiträge zu errechnen.
Ausnahmen vom automatisierten Verfahren: steuerlich nicht erfasste Kinder
In Ausnahmefällen sind Kinder steuerlich nicht erfasst. Das können zum Beispiel Pflegekinder sein. Für diese Kinder können keine Daten über das automatisierte Verfahren übermittelt werden. Stiefkinder werden im automatisierten Verfahren grundsätzlich nicht gemeldet. Das digitale Verfahren bietet somit nicht für alle eine verbindliche Grundlage, um die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder zu ermitteln.
Liegen Arbeitgebern oder der Pflegekasse Informationen vor, die von der Meldung des Bundeszentralamtes für Steuern abweichen, müssen sie diese aufklären. Beschäftigte müssen steuerlich nicht gemeldete Kinder beim Arbeitgeber nachweisen, zum Beispiel durch eine Geburtsurkunde. Von den betroffenen Personen vorgelegte Nachweise zur Elterneigenschaft bzw. zur Anzahl der Kinder sind in diesen Fällen – ungeachtet der abweichenden Meldung des BZSt – anzuerkennen.
Ab wann werden die Kinder-Nachweise berücksichtigt?
Vor dem 1. Juli 2023 geboren
Bei Kindern, die vor dem 1. Juli 2023 geboren sind, gilt der Nachweis über die Beitragsabschläge bzw. über den Kinderlosenzuschlag zum 1. Juli 2023.
Für Kinder, die zwischen dem 1. April 2023 und dem 30. Juni 2023 geboren wurden, gilt der Nachweis mit Beginn des Monats der Geburt, wenn er innerhalb von 3 Monaten nach der Geburt vorgelegt wurde.
Nach dem 1. Juli 2023 geboren
Für Kinder, die in der Übergangszeit vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2025 geboren wurden, wird der Nachweis zum Beginn des Geburtsmonats berücksichtigt. Der Nachweis ist an keine Frist gebunden, so dass er auch später erbracht werden kann und zurückwirkt.
Nach dem 1. Juli 2025 geboren
Für die Kinder, die nach dem 1. Juli 2025 geboren werden, muss der Nachweis innerhalb von drei Monaten nach der Geburt des Kindes erbracht werden. Die Abschläge gelten dann mit Beginn des Monats der Geburt. Wird der Nachweis später eingereicht, gilt er ab dem Monat nach der Einreichung.
Besonderheiten bei Stief- und Adoptivkinder
Bei Adoptiveltern und Stiefeltern muss die Adoption oder Eheschließung zu einem Zeitpunkt erfolgt sein, an dem für das Kind altersmäßig eine Familienversicherung besteht oder hätte bestehen können.
Das heißt:
- Adoptivkinder werden nicht berücksichtigt, wenn zum Zeitpunkt der Adoption das Kind die Altersgrenzen für eine Familienversicherung erreicht hat (siehe Infobox unten).
- Stiefkinder werden nicht berücksichtigt, wenn zum Zeitpunkt der Eheschließung oder Begründung der eingetragenen Lebenspartnerschaft das Kind bereits die Altersgrenzen in der Familienversicherung erreicht hat oder wenn das Kind vor Erreichen dieser Altersgrenzen nicht in den gemeinsamen Haushalt mit dem Mitglied aufgenommen worden ist.
Stiefkinder werden dagegen weiterhin berücksichtigt, wenn die Ehe oder Lebenspartnerschaft, durch die das Stiefkindschaftsverhältnis begründet wurde, geschieden oder aufgelöst wird oder der leibliche Elternteil verstirbt.
Altersgrenzen in der Familienversicherung
- Kinder können grundsätzlich bis zu ihrem 18. Geburtstag in der Familienversicherung bleiben.
- Kinder ohne Erwerbstätigkeit können bis zum 23. Geburtstag familienversichert bleiben.
- Kinder in Schul- oder Berufsausbildung oder im Freiwilligendienstes können bis zum 25. Geburtstag in der Familienversicherung bleiben.
- Für Kinder, die behinderungsbedingt außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, gibt es keine Altersgrenze.
Hinweise des GKV-Spitzenverbandes