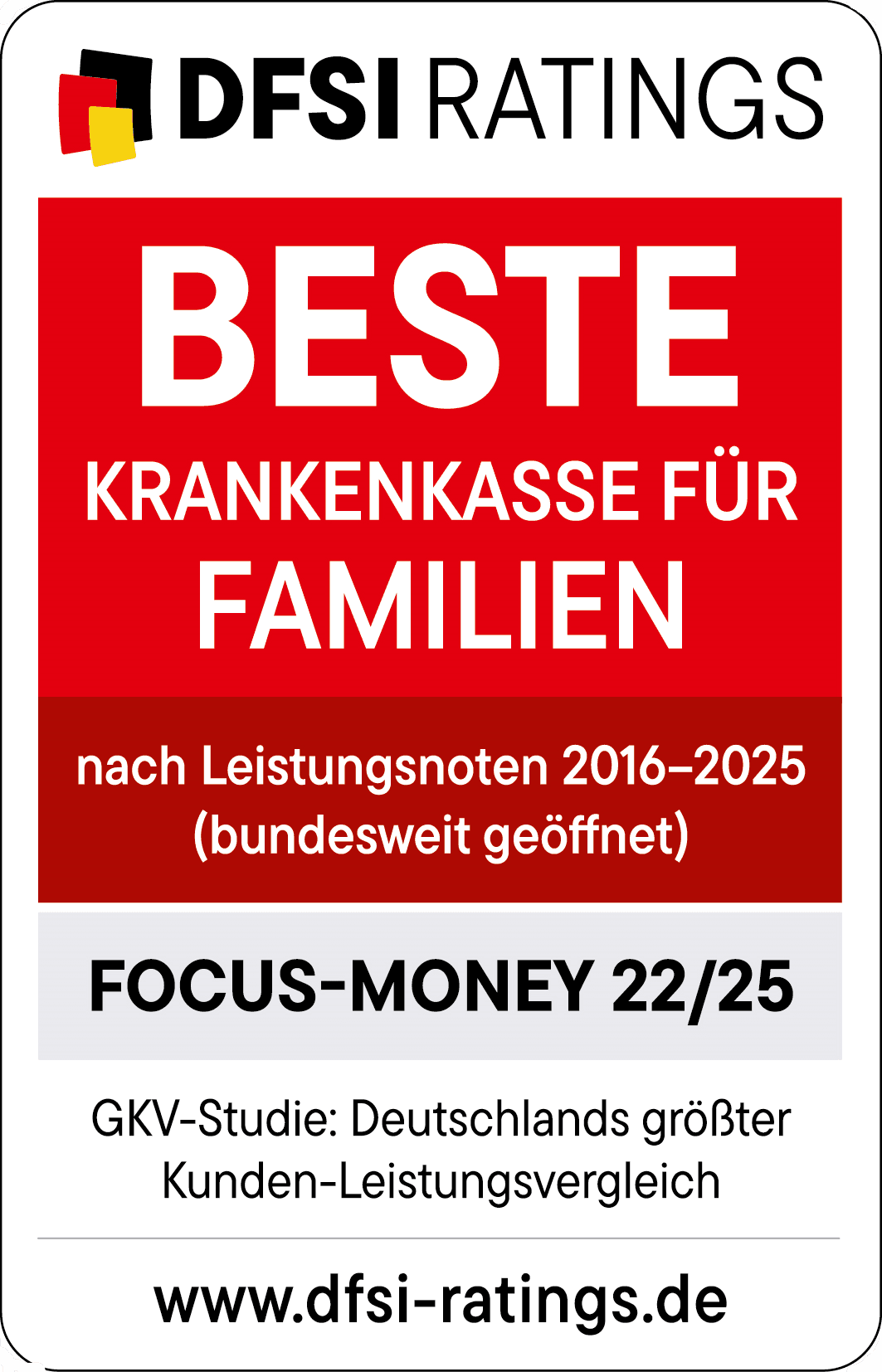Erste Hilfe am Kind: Gefahrenquellen und Anleitungen für den Ernstfall

Ein verschlucktes Spielzeug, ein Sturz vom Klettergerüst oder eine Hand auf der heißen Herdplatte: Innerhalb von Sekunden kann aus einer spielerischen Situation ein Notfall werden. Dann ist schnelles Handeln gefragt. Um im Ernstfall richtig zu reagieren, können Eltern spezielle Erste-Hilfe-Kurse für Kinder absolvieren.
Hier die häufigsten Unfälle und Gefahrenquellen und kurze Anleitungen, wie Sie Ihrem Kind helfen.
Erste Hilfe am Kind: Wichtige Grundregeln und Handgriffe
Unfälle mit Babys oder Kindern lassen sich nicht immer vermeiden. Umso wichtiger ist es, im Notfall zu wissen, was zu tun ist.
- Beruhigen Sie das Kind und retten Sie es aus akuter Gefahr!
- Verschaffen Sie sich rasch einen Überblick!
- Sichern Sie die Gefahrenstelle ab!
- Untersuchen Sie Ihr Kind auf Verletzungen!
- Kontrollieren Sie Atmung und Herzschlag!
- Wenn nötig mit Atemspende und Herzmassage beginnen!
- Lassen Sie das Kind nicht allein!
- Holen Sie Hilfe!
- Bei Herz- und Atemstillstand immer sofort den Notruf 112 wählen!
- Tipp: Üben Sie das Auffinden des Pulses am gesunden Kind.
Erste Hilfe für Kinder: Tipps von der Notärztin im Video
5 Typische Notfallszenarien bei Babys und Kindern
1. Kind erleidet Verbrühung/Verbrennung
Kindliche Haut ist sehr viel empfindlicher als die Haut eines erwachsenen Menschen. Kinder empfinden Temperaturen als „heiß“, die Erwachsene als „lauwarm“ bezeichnen würden. Darum ist es wichtig, die Zeitspanne, in der Hitze auf die Haut des Kindes einwirken kann, so kurz wie möglich zu halten.
Die Gefahr: Eine Verbrühung ist eine Verletzung durch heiße Flüssigkeit, bei der die Regulationsfähigkeit der Haut überfordert wird. Die Schwere der Verletzung hängt von der Temperatur der Flüssigkeit, der Dauer der Einwirkung, der verletzten Körperregion und der Art der Flüssigkeit ab. Der häufigste Unfallmechanismus
ist das Überschütten mit heißer Flüssigkeit.
Kinder wollen ihre Umgebung erforschen, ziehen Tassen mit heißen Getränken vom Tisch, Töpfe mit brodelnder Flüssigkeit vom Herd oder greifen nach dem Wasserkocher.
Verbrühungen werden unterschieden nach der Art der Verletzung …
- Grad 1: Schmerzen und Rötungen der Haut (wie bei einem Sonnenbrand)
- Grad 2 a: Rötung und Blasenbildung, starke Schmerzen
- Grad 2 b: weißlicher Wundgrund, zerfetzte Blasen, Schmerzen
- Grad 3: trockene, lederartige weiße Verdickung der Haut, wenig Schmerzen
... und nach der Ausdehnung der Verletzung
- Faustregel: Die Handinnenfläche eines Kindes entspricht 1% seiner Körperoberfläche.
- Wenn mehr als 10% der Körperoberfläche betroffen sind, ist die Verletzung ernst.
Verbrühungen und Verbrennungen haben schwerwiegende Folgen:
- Wohnungsbrände machen 90% der thermischen Verletzungen mit Todesfolge aus (Rauchgasinhalation).
- Bei 54 °C Wassertemperatur erleidet ein Erwachsener nach 31 Sekunden eine Verbrühung dritten Grades, bei einem Kleinkind dauert dies nur 10 Sekunden.
- Bedeckte Körperteile sind stärker betroffen.
- Ölige Flüssigkeiten haben höhere Temperaturen als Wasser und eine längere Kontaktzeit (Öl 170 °C; Teer sogar 204–260 °C)
- Kontaktverbrennungen (Feuer, Glut) führen meist zu tieferen Verbrennungen dritten Grades.
- Textilbrände, z. B. durch Kerzen, sind katastrophal, von großer Ausdehnung und entsprechen Grad 3.
- Chemische Verbrennungen (Lampenöl) führen sehr häufig zu tiefen Läsionen.
Erste Hilfe bei Verbrühungen/Verbrennungen:
- Bewahren Sie Ruhe und beruhigen Sie das Kind.
- Ziehen Sie dem Kind nasse Kleidungsstücke aus, eingebrannte Kleidung nie mit Gewalt entfernen!
- Kühlen Sie zur Schmerztherapie die betroffene Stelle unter fließendem handwarmen Wasser.
- Fahren Sie zum Kinderarzt oder ins Krankenhaus, bei großen Flächen wählen Sie den Notruf 112.
- Wickeln Sie das Kind in eine Rettungsfolie aus dem Verbandskasten (die goldene Seite zum Kind), legen Sie Verbände an oder wickeln Sie das Kind in saubere Tücher (z.B. frische Handtücher).
Verwenden Sie niemals
- Brandsalben, Brandbinden, Öl
- Mehl oder Puder
- Zahnpasta, Heilpflanzenöl, Tigerbalsam
- Salzwasser
- Eis oder Eiswasser
Verbrühungen/Verbrennungen vorbeugen
- In der Küche: Wasserkocher, Samowar, Fritteuse sicher aufstellen, Stromkabel stolperfrei anbringen.
- Beim Kochen und Backen: Kinder vor spritzendem heißem Wasser und Fett schützen.
- Im Badezimmer: Heißes Wasser – Kinder nicht allein baden lassen.
- Beim Bügeln: Elektrische Zuleitung stolperfrei anbringen, Bügeleisen zum Auskühlen hochstellen.
- Beim Grillen: Nie die Grillkohlen anfassen, auch wenn die Glut erloschen scheint.
2. Kind verschluckt Fremdkörper
- Kleine Kinder nehmen Gegenstände aus Neugier in den Mund. Fremdkörper wie Erdnüsse, Münzen, Reißzwecken, Steinchen, Legosteine, Murmeln, Knopfzellenbatterien etc. nehmen den
falschen Weg in Luftröhre oder Lunge. Die Atemwege werden blockiert, das Kind bekommt keine Luft mehr. - Häufiger ist: Kinder verschlucken kleine Gegenstände.
- Die meisten Fremdkörper passieren ungehindert – und ohne Verletzungen hervorzurufen – den kindlichen Magen-Darm-Trakt und tauchen nach zwei bis fünf Tagen (manchmal auch noch später) im Stuhl auf.
Mögliche Folgen:
- Atemnot
- Hustenreiz
- Fremdkörpergefühl
- Vermehrter Speichelfluss
- Würgereiz, Würgen
- Schluckbeschwerden
Erste Hilfe bei Verschlucken von Fremdkörpern:
- Bewahren Sie Ruhe und beruhigen Sie das Kind.
- Beobachten Sie, ob das Kind schlecht Luft bekommt oder blass aussieht. Achten Sie auf vermehrten Speichelfluss.
- Hustet das Kind häufig? Fühlt das Kind einen Fremdkörper im Hals? Beobachten Sie, ob das Kind gehäuft schluckt.
- Legen Sie das Kind mit Kopf und Bauch nach unten auf den eigenen Unterarm und klopfen Sie kräftig auf den Rücken zwischen den Schulterblättern. Größere Kinder vornüberbeugen und durch Schläge auf die Brust zum Husten bringen.
- Fremdkörper herausgebracht? Kann das Kind schlucken und atmen, ist die akute Gefahr gebannt.
- Im Zweifel fahren Sie sofort zum nächsten Kinderarzt/ Krankenhaus oder wählen Sie den Notruf 112.
DAK App mit Familien-Service
Mit unserer App erledigen Sie die Anliegen Ihrer Kinder schnell und einfach.
3. Kind stürzt
- Hochrisikoalter ist das Säuglings- und Kleinkindalter.
- Jeder zweite Unfall ist ein Sturzunfall.
- Aufgrund ihres Körperbaus und ihrer Physiologie stürzen Babys und Kleinkinder eher auf den Kopf.
- Schulkinder können sich besser abstützen und verletzen sich daher eher an Armen oder Händen bzw. Beinen (Distorsionen, Frakturen).
Erste Hilfe bei Stürzen:
- Bewahren Sie Ruhe und beruhigen Sie das Kind.
- Bei Herz- und Atemstillstand sofort mit Mund-zu-Nase-Beatmung und Herzmassage beginnen und den Notruf 112 wählen.
- Lagern Sie das Kind flach, am besten auf dem Boden. Tragen Sie es nicht unnötig umher, auch nicht, um es bequemer hinzulegen. Bei Bewusstlosigkeit auf die Uhr sehen, um die Zeitdauer genau festzuhalten.
- Durch die Aufregung erscheinen Sekunden wie Minuten. Bei wachem Kind Bewusstsein prüfen. Kopf leicht erhöht lagern.
- Stellen Sie einfache Fragen, die dem Alter des Kindes angemessen sind.
Stürzen vorbeugen
- Sturz vom Wickeltisch: Immer eine Hand am Kind!
- Aus dem Gitterbett: Gitterstäbe entfernen und kleinen Ausgang schaffen, sobald das Kind sich hochzieht!
- Gehfrei, Babywalker, „Lauflernhilfe“ nicht verwenden!
- Babyschalen nicht auf Tisch, Waschmaschine oder Bett/Wasserbett stellen!
- Kippsichere Kinderhochstühle verwenden!
Fenster und Balkone sichern!
Warum sind Kinder besonders gefährdet?
- Säuglinge und Kleinkinder haben andere Proportionen als Erwachsene.
- Der Kopf eines einjährigen Kindes ist in Relation zu Erwachsenen doppelt so groß.
- Der Schwerpunkt des Kleinkindes liegt im Hals-Schulter-Bereich.
- Das Gesichtsfeld eines Erwachsenen erreicht ein Kind erst im Alter von 10 bis 12 Jahren.
- Ein Kind kann ohne Bewegung von Augen und Kopf viel weniger von dem überschauen, was ein Erwachsener wahrnimmt.
Erste Hilfe bei Kopfverletzungen:
- Bewahren Sie Ruhe und beruhigen Sie das Kind.
- Lagern Sie das Kind flach, am besten auf dem Boden.
- Ist das Kind bewusstlos: Schauen Sie auf die Uhr, um die Zeitdauer genau festzuhalten.
- Ist das Kind wach: Stellen Sie dem Kind einfache Fragen und sprechen Sie ruhig mit dem Kind über vertraute Dinge, lassen Sie es nicht einschlafen.
- Falls das Kind anfängt zu erbrechen, halten Sie die Atemwege frei.
- Ist das Kind schläfrig oder lässt sich eine Platzwunde nicht stillen: Wählen Sie den Notruf 112!
Knochenbrüche
- Einige Knochenbrüche erkennt man sofort, z. B. wenn der gebrochene Knochen durch die Haut spießt oder drückt.
- Viel öfter ist der Knochen zwar gebrochen, aber die Bruchenden haben sich nicht gegeneinander verschoben, äußerlich lässt sich nichts feststellen.
- Zudem sind Kinder häufig in der Lage, trotz Knochenbruch Arm oder Bein zu bewegen – manche Kinder laufen sogar mit einem gebrochenen Bein umher.
- Bei Kleinkindern ist Krabbeln, obwohl das Kind eigentlich schon läuft, ein möglicher Hinweis auf einen Knochenbruch.
- Oft findet sich ein Bluterguss an der Verletzungsstelle.
- Nur ein Arzt kann Prellung, Bluterguss, Verstauchung und Knochenbruch sicher voneinander unterscheiden!
Erste Hilfe bei Knochenbrüchen:
- Bewahren Sie Ruhe und beruhigen Sie das Kind.
- Entfernen Sie vorsichtig beengende Kleidungsstücke (Schuhe, Strümpfe) oder Ringe und Armbänder von einer verletzten Hand. Eine Schwellung kann rasch größer werden und späteres Ausziehen schmerzhaft oder unmöglich machen.
- Bei Verletzungen an Armen und Beinen: Befreien Sie zuerst den unverletzten – dann den verletzten Körperteil.
- Betrachten Sie die Verletzung genau: Bestehen verdächtige Beulen, Schwellungen oder sogar eine offene Wunde?
- Verbinden Sie offene Wunden mit Kompressen aus dem Verbandskasten oder decken Sie sie ab (sauberes Handtuch).
- Liegt keine deutlich sichtbare Fehlstellung vor: Machen Sie kalte feuchte Wickel oder kühlen Sie die Stelle mit einem Kühlkissen, mit zerstoßenem Eis oder tiefgefrorenen Erbsen in einer Plastiktüte (in ein Tuch einwickeln).
- Kälte hilft, den Bluterguss klein zu halten, und lindert Schmerzen.
- Vermeiden Sie unnötige Bewegungen des verletzten Körperteils.
- Warten Sie, bis der erste Schreck abgeklungen ist, und untersuchen Sie die Verletzung noch einmal. Hat das Kind starke Schmerzen oder kann es die verletzte Stelle nicht bewegen, legen Sie einen stützenden Verband an (z. B. Dreieckstuch bei Verletzung am Arm), wenn dies dem Kind angenehm ist.
- Versuchen Sie nicht, Beine notdürftig zu schienen, Sie fügen dem Kind nur unnötige Schmerzen zu.
- Geben Sie dem Kind nichts mehr zu essen oder zu trinken!
- Fahren Sie zum nächsten Kinderarzt/ Krankenhaus oder wählen Sie den Notruf 112
Wunden
- Machen Sie den behandelnden Arzt unbedingt darauf aufmerksam, wodurch die Verletzung entstanden ist. Platzwunden, Quetschwunden und Risswunden sind die häufigsten Wundverletzungen.
- Platzwunden am Kopf bluten zuerst stark, die Blutung hört aber oft nach kurzer Zeit von selbst auf.
- Kratzwunden und Bisswunden stammen meist von Tieren oder anderen Kindern. Sie sind praktisch immer mit Keimen verschmutzt (auch wenn es nicht so aussieht) und müssen besonders sorgfältig behandelt werden.
Erste Hilfe bei Wunden:
- Wichtig: Arbeiten Sie immer möglichst sauber!
- Stillen Sie die Blutung. Die meisten Blutungen werden nach kurzer Zeit von selbst schwächer oder hören ganz auf. Kalte, feuchte Tücher (z. B. Waschlappen mit kaltem Wasser) fördern die Blutstillung und kleben nicht an der Wunde fest.
- Wenn das Blut spritzt oder pulsiert: Decken Sie erst die Wunde sauber ab (z. B. Kompressen aus dem Verbandskasten, sauberes Handtuch), legen Sie dann einen Druckverband auf der Wunde an.
- Druckverband: Wichtig ist, dass Druck aufgebaut wird – nicht, dass der Verband perfekt aussieht. Prüfen Sie immer, ob der Puls jenseits des Verbandes tastbar ist. Wenn nicht, lockern Sie den Verband etwas.
- Versuchen Sie zur Information des Arztes zu schätzen, wie viel Blut das Kind verloren hat. (Wie viel Blut war auf dem Boden? Wie viele Handtücher waren blutdurchtränkt?)
- Bei nicht stark blutenden Wunden: Reinigen Sie die Wunde mit einem Wunddesinfektionsmittel (es gibt mittlerweile zahlreiche Produkte, die nicht brennen).
- Decken Sie jede Wunde sauber ab (Verband, sauberes Handtuch). So wird die Wunde vor Keimen geschützt, und das Kind hat weniger Schmerzen.
- Vermeiden Sie unnötige Bewegungen des verletzten Körperteils.
- Geben Sie dem Kind nichts mehr zu essen oder zu trinken!
- Fahren Sie zum nächsten Kinderarzt/ Krankenhaus oder wählen Sie den Notruf 112.
- Wichtig: Impfausweis mitnehmen, u.a. wegen Tetanusschutz!
4. Kind erleidet Vergiftung
- Etwa 6.000–8.000 Kinder pro Jahr werden stationär im Krankenhaus behandelt.
- Medikamente sowie Putz- und Reinigungsmittel sind zu etwa 80% für die Vergiftung verantwortlich.
- Vergiftungen sind selten tödlich.
Erste Hilfe bei Vergiftungen:
- Bewahren Sie Ruhe und beruhigen Sie das Kind.
- Öffnen Sie den Mund des Kindes und entfernen Sie die Reste des Eingenommenen. Finden Sie heraus, um welche Chemikalie bzw. Pflanze es sich handelt.
- Geben Sie dem Kind vorsichtig etwas Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken.
- Achtung: Kein Wasser mit Kohlensäure, keine Milch und keinen Saft!
- Das Kind darf beim Trinken keinen Brechreiz bekommen – die ätzende Substanz würde erneut die Speiseröhre passieren und eine zusätzliche Schädigung verursachen.
- Rufen Sie das Giftnotrufzentrum (siehe unten) an und folgen Sie den Anweisungen.
- Bei lebensbedrohlichen Symptomen, wie Atemstörungen oder plötzlicher Bewusstlosigkeit, sofort den Notruf 112 wählen.
- Wichtig: Wenn Sie zum Kinderarzt/ Krankenhaus fahren, nehmen Sie das Eingenommene oder die Verpackung unbedingt mit, damit die Ärzte gezielt helfen können.
5. Gefahren rund ums Wasser
Ertrinkungsunfälle
- Nach dem Säuglingsalter häufigster tödlicher Heim- und Freizeitunfall
- Typisches Unfallszenario bei Säuglingen und Kleinkindern
- Dramatische Folgen von Beinaheunfällen
- Wasserspielzeuge sind keine Schwimmhilfe!
Gefahren rund ums Wasser vorbeugen
- Kinder ertrinken leise!
- Im Badezimmer: Kinder nie allein baden lassen
- Pool und Regentonne absperren oder sichern
- Beim Schwimmen und am Wasser: Schwimmhilfen müssen je zwei Luftkammern haben
- Nicht in unbekannten Gewässern baden
- Nicht in unbekannte Gewässer springen, erst recht nicht kopfüber
Erste Hilfe bei Ertrinkungsunfällen:
- Bewahren Sie Ruhe.
- Bei Herz- und Atemstillstand sofort mit Atemspende und Herzmassage beginnen (während der Bergung im Wasser!).
- Verlassen Sie das Kind nicht, und lassen Sie durch eine zweite Person den Notarzt verständigen: Notruf 112.
- Bringen Sie das Kind schnell ins Krankenhaus.
- Versuchen Sie nicht, Wasser aus Lunge oder Magen zu entfernen. Diese Maßnahmen kosten nur Zeit und haben keinen Nutzen.
Was Sie sonst noch tun können:
- An einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen
- www.kindersicherheit.de für weitere Informationen besuchen
- Halten Sie eine gut ausgestattete Hausapotheke parat
Fragen an Kinderfachärztin Dr. med. Katharina Ried
Dr. med. Katharina Rieth, Kinderfachärztin, Intensivmedizinerin und Notärztin, ist es ein besonderes Anliegen, für mehr Sicherheit im Umgang mit kritischen Situationen zu sorgen. Uns erläutert sie im Interview, worum es ihr geht.
Von Austrocknung über Luftnot bis hin zur Vergiftung: Nach einem Blick auf das Register Ihres Buches könnte es einem vor dem Leben mit Kindern angst und bange werden. Dabei sind Kindernotfälle, wie Sie sagen, doch selten …
Dr. med. Katharina Rieth: „Genau da liegt das Problem: Anstatt fehlende Routine durch Üben und gezielten Wissenszuwachs auszugleichen, flüchten sich viele in die scheinbare Sicherheit des „Wird schon nichts passieren – und wenn, dann nicht mir“-Gefühls. Dies führt dazu, dass Kindernotfälle oft zu spät erkannt werden. Wenn im Ernstfall zu zögerlich gehandelt wird, kann das fatale Folgen haben. Es geht also keineswegs darum, Angst zu verbreiten, sondern darum, Eltern und alle, die mit Kindern zu tun haben, für das Thema der Kindernotfallmedizin zu sensibilisieren. Und wichtiger noch, sie mit den entsprechenden Fähigkeiten auszustatten, damit im Notfall ein rasches Erkennen, Handeln und somit Leben Retten möglich wird. Bestenfalls werden außerdem frühzeitig vorbeugende Maßnahmen ergriffen, damit es gar nicht erst zu so einer Situation kommt."
Was empfehlen Sie allen, die mit Kindern umgehen, vom Opa über die Kindergärtnerin bis zum Babysitter, um sich für Notfälle fit zu machen? Sollte man sein Know-how immer wieder auffrischen und regelrecht trainieren?
Dr. med. Katharina Rieth: „Ich kann nur jedem ans Herz legen, sich eingehend damit zu beschäftigen. Im Notfall erst irgendwo nachzulesen oder ein Video zu schauen macht überhaupt keinen Sinn. Wichtig sind auch regelmäßige Wiederholungen. In Vor-Ort-Kursen sind oft nicht mehr als zwei oder drei Runden „Drücken“ und „Pusten“ oder das Üben verschiedener Manöver zur Entfernung von Fremdkörpern aus den Atemwegen an der Puppe drin, dann ist der Tag schon wieder gelaufen. Das ist aber nicht genug! Wichtige Informationen, um brenzlige Situationen zu verhindern und spezielle Notfälle zu erkennen, sind in solchen Kursen sowohl zeitlich als auch häufig fachlich gar nicht möglich."
Was sind die häufigsten Kindernotfälle? Und was könnte man dabei besonders leicht falsch machen?
Dr. med. Katharina Rieth: „In acht von zehn Fällen geht es um Atemwegsproblematiken, Krampfanfälle und unfallbedingte Verletzungen. Häufig wird zu lange abgewartet, sei es aus Angst, etwas falsch zu machen, oder aus der falschen Erwartung heraus, dass „der Rettungsdienst ja gleich kommt“. Nach Absetzen eines Notrufs kann es zehn Minuten oder länger dauern, bis professionelle Hilfe eintrifft. In dieser Zeit müssen im Ernstfall dringend lebensrettende Maßnahmen ergriffen werden."
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“, diesen Satz hat wohl jeder schon mal gehört. Doch welche Besonderheiten der Jüngsten sind es konkret, die bei Notfällen beachtet werden müssen?
Dr. med. Katharina Rieth: „Kinder unterscheiden sich sowohl anatomisch, physiologisch als auch emotional stark vom Erwachsenen. Sie haben zum Beispiel einen höheren Sauerstoffverbrauch bei gleichzeitig geringeren Sauerstoffreserven. Bei einem Atemstillstand zählt deshalb jede Sekunde und es sollte noch vor der Herzdruckmassage fünfmal beatmet werden. Außerdem versagt der Kreislauf von Kindern viel rascher bei Blutverlust durch Verletzungen oder Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen, Durchfall oder Schwitzen. Und sie haben ein viel elastischeres Skelettsystem. Bei Unfällen mit hoher Krafteinwirkung auf den Körper wird diese deshalb auf innere Organe übertragen. So kann es zu gefährlichen Organrissen mit Blutungen kommen, ohne dass man äußerlich viel sieht."
Wie bekommt man als Laie die Panik in den Griff, wenn ein Notfall vorliegt?
Dr. med. Katharina Rieth: „Ruhe zu bewahren ist das A und O, ganz unabhängig vom Ausbildungsstand. Angst lähmt und Respekt beflügelt! Im Notfall also ruhig durchatmen, Situation überblicken, eigene Sicherheit nicht vergessen, die sogenannten Vitalparameter Bewusstsein, Atmung und Kreislauf kontrollieren und sichern, Hilfe- beziehungsweise Notruf nicht vergessen und immer erst dann lebensrettende Maßnahmen beenden, wenn man durch professionelle Helfer oder Helferinnen abgelöst wird."
Was ist bei Kindern als Patientinnen und Patienten noch anders als bei den Großen und welche Strategien haben sich da bewährt?
Dr. med. Katharina Rieth: „Kinder verstehen häufig nicht, warum spezielle Maßnahmen durchgeführt werden müssen, haben Angst, sind verunsichert und würden am liebsten weglaufen. Deshalb ist es umso wichtiger, sein Kind auf Arztbesuche vorzubereiten, selbst Ruhe zu bewahren, um diese auch ausstrahlen zu können, es zu unterstützen, statt ihm Angst zu machen oder zu drohen, Vertrauen zu schaffen. Und es auch mal zu loben, wenn das Blutabnehmen oder das Schlucken der ungeliebten Tablette besonders gut gelaufen ist."
Was sind Faustregeln, um Notfälle möglichst schon im Vorfeld zu vermeiden?
Dr. med. Katharina Rieth: „Um Unfallgefahren im Haushalt und im Garten zu erkennen, lohnt es sich, sich mal auf den Entwicklungsstand seines Kindes einzulassen und aus dessen Augen das Zuhause zu inspizieren. Um Krankheitsbilder rascher erkennen zu können, muss man vorher mal etwas davon gehört haben, und um den Gesundheitszustand seines Kindes einschätzen zu können, muss man mit bestimmten Tools vertraut sein."
Wir erleben Sie Eltern heute: Gibt es eher die Überbesorgten, die schon mit einem aufgeschlagenen Knie in die Notaufnahme eilen, oder die Unbekümmerten? Gehen wir mit der Thematik weniger souverän um als frühere Generationen?
Dr. med. Katharina Rieth: „Im Laufe der letzten zehn Jahre zeigt sich in der Kinderheilkunde tatsächlich eine Tendenz hin zu überbesorgten Eltern, die aufgrund verlorengegangener Gesundheitskompetenz und auch fehlender Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung mit Wehwehchen die Notaufnahmen und Praxen überschwemmen und dabei trotz allem den Anspruch haben, möglichst umgehend behandelt zu werden. Aufgrund der Informationsflut im Internet könnte man eigentlich meinen, Eltern seien informierter und aufgeklärter als früher. Doch das Gegenteil ist der Fall. Im Netz sind leider viele schwarze Schafe unterwegs, die munter gefährliches Halbwissen posten. So kommt es häufig dazu, dass wir Kinder behandeln müssen, deren Eltern gutgemeinte Ratschläge von Laien aus Elternforen angenommen und damit ihrem Kind mehr geschadet als geholfen haben."
Wie könnte der goldene Mittelweg zwischen Überbehüten und fahrlässiger Sorglosigkeit aussehen?
Dr. med. Katharina Rieth: „Eine gute Gesundheitskompetenz ist dabei der Schlüssel. Dazu müssen Informationen von fachlich kompetenter Seite kompakt, professionell und pädagogisch hochwertig aufbereitet übermittelt werden. Aufklärung führt dazu, dass wieder Verantwortung übernommen wird und nicht eine Problemverschiebung erfolgt. So können die Eltern selbst viele Notfälle durch Prävention verhindern oder durch rechtzeitiges Erkennen einer sinnvollen Therapie zuführen. Kleinere Wehwehchen könnten wieder mittels einer gut ausgestatteten Hausapotheke bekämpft werden. Damit wäre allen Seiten geholfen!"

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Erste Hilfe am Kind: Aufgezeichnetes Seminar
Maßnahmen und Tipps für den Notfall von PD Dr. Stefanie Märzheuser.

Kindersicherheit zu Hause
Seminar-Aufzeichnung und Handout mit Tipps für einen kindgerechten und sicheren Haushalt.

Kindervorsorge
Bei uns sind nicht nur die üblichen Vorsorgeuntersuchungen kostenfrei. Auch die U10, U11 und J2 gehören dazu.