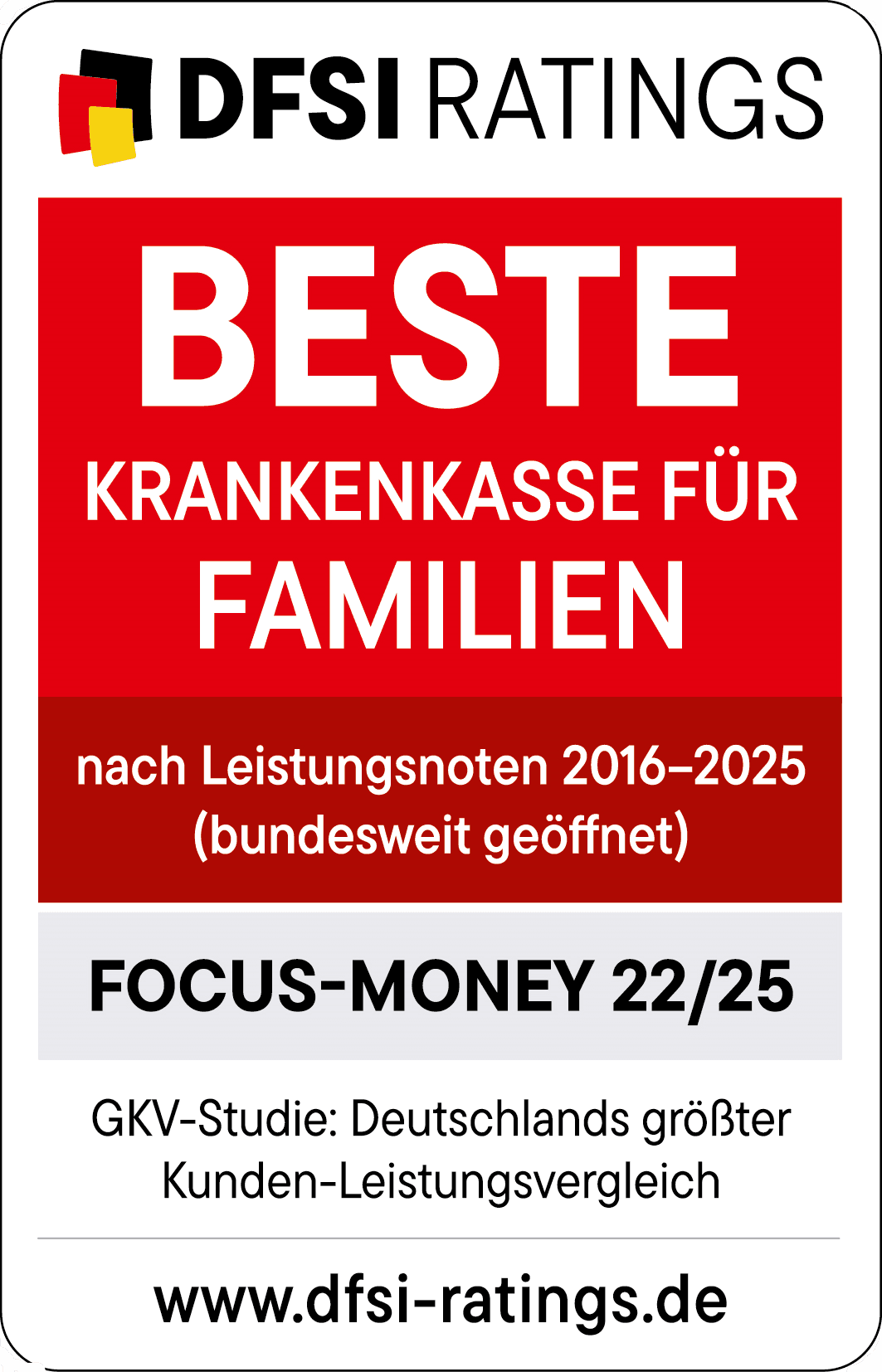Narben: Entstehung und Behandlung

Verletzungen, Erkrankungen oder Operationen hinterlassen häufig ihre Spuren auf der Haut: Narben. Was für die einen ein persönliches Markenzeichen ist, kann für die anderen mit einem mitunter langwierigen Heilungsprozess zusammenhängen. In unserem kleinen Ratgeber erfährst du, wie Narben eigentlich entstehen, welche Narbentypen es gibt und wie sie sich am besten behandeln lassen.
Du hast dich an der Herdplatte verbrannt? Bist die Treppe im Hausflur mehr gefallen als gestiegen? Wurdest von deiner Katze mit einem beherzten Biss in die Hand überrascht? Dann stehen die Chancen gut, dass es erst mal „Aua“ macht. Aber nicht nur das. Widerfährt dir ein Malheur dieser Art, kann das zu Einrissen in der Haut führen. Werden dabei nur die oberen Schichten der Oberhaut (Epidermis) in Mitleidenschaft gezogen, veranlasst der Körper die sogenannte regenerative Wundheilung: Hierbei bildet sich innerhalb eines Monats neues Hautgewebe. Reicht die Verletzung allerdings bis in die zweite Hautschicht (Lederhaut) hinein, genügt diese Art der Wiederherstellung nicht. Dann setzt die sogenannte reparative Wundheilung ein, bei der sich über kurz oder lang Narben bilden.
Wie entstehen Narben?
Der Körper „flickt“ die verletzte Haut durch Bindegewebe, das zum Beispiel auch in Sehnen, Bändern oder zwischen Organen zu finden ist. Dabei bildet sich von den Wundrändern aus neues, nicht sehr stabiles Gewebe, das vom Körper mit dem faserigen Protein Kollagen aufgefüllt wird. Das so entstandene Bindegewebe ist zwar ziemlich stabil und erfüllt damit die Funktion des „Flickens“ optimal, ihm fehlen im Gegensatz zu normaler Haut aber die Schweißdrüsen, Haare, Gefäße und Pigmentzellen. Aus diesem Grund wird es bei einem ausgiebigen Sonnenbad auch nicht braun.
Dafür kommt eine frische Narbe aufgrund der gesteigerten Blutzufuhr erst einmal mit rotem Teint daher. Zudem ist sie in der Regel „erhaben“ – das bedeutet, dass im Vergleich zum umliegenden Hautniveau leicht hervorragt. Mit der Zeit geht die Durchblutung zurück und auch das Kollagen zieht sich zusammen, wodurch wird die Narbe blasser, flacher und weicher wird. Bis es so weit ist, können allerdings bis zu zwei Jahre ins Land gehen. Läuft alles gut, bleibt eine unauffällige Narbe zurück, die dich kaum bis gar nicht beeinträchtigt und möglicherweise sogar als optisches Markenzeichen deine Individualität unterstreicht. In manchen Fällen hingegen verläuft die Wundheilung nicht optimal, was nicht nur Jucken und Schmerzen, sondern auch ein kosmetisch ungünstiges Narbenbild nach sich ziehen kann.
Welche Narbentypen gibt es?
Narben können sich stark voneinander unterscheiden – sei es nun in puncto Aussehen, Beschaffenheit oder Beschwerdepotenzial. Ärztinnen und Ärzte unterscheiden zwischen folgenden gängigen Narbentypen:
- Beschwerdefreie Narben: Zeichnen sich durch eine komplikationslose Heilung aus, heben sich kaum von der gesunden Haut ab, sind weich und verschiebbar.
- Aktive Narben: Bleiben durch eine chronische Reizung des Narbengewebes länger gerötet und können über einen längeren Zeitraum schmerzen.
- Hypertrophe Narben: Bildet sich zu viel Bindegewebe, bleibt diese oft juckende, erhabene und verdickte Narbenvariante zurück. Hypertrophe Narben treten meist nach Verbrennungen oder Verletzungen an Beugestellen (Knie, Ellenbogen etc.) auf, die regelmäßig beansprucht werden. Sie sind beschränkt auf das Wundgebiet und bilden sich häufig von allein zurück.
- Keloide Narben: Auch hier liegt eine Überproduktion an Bindegewebe vor, allerdings überschreiten Keloide den Wundrand und gehen in der Regel auf eine familiäre Veranlagung oder dunkle Hautfarbe zurück. Sie bilden sich für gewöhnlich nicht zurück, sondern wachsen im Gegenteil immer weiter.
Hautkrebs-Screening
Ab 35 Jahren übernehmen wir alle 2 Jahre die Kosten für die Früherkennungsuntersuchung.
- Atrophe Narben: Bei diesen Narben bildet sich zu wenig Bindegewebe, weshalb sie unterhalb des Hautniveaus liegen und verzögert heilen. Sie sind straff, nicht verschiebbar, schlecht durchblutet und verursachen bei vielen Betroffenen Jucken und Schmerzen. Atrophe Narben treten typischerweise infolge von Pickeln als Aknenarben im Gesicht oder nach Windpocken auf.
- Narbenkontrakturen: Diese Variante, auch Sklerotische Narbe genannt, ist vorwiegend hart, unelastisch und mit dem umliegenden Gewebe verklebt. Sie tritt häufig im Bereich von Gelenken auf, vermindert entsprechend die Beweglichkeit und geht eher auf großflächige Verletzungen, Verbrennungen oder Entzündungen zurück.
Hausmittel und Tipps zur Behandlung von Narben
Bei der Narbenpflege entscheiden besonders zwei Aspekte über den Erfolg: Zum einen ist es hilfreich, möglichst früh mit der Pflege zu beginnen, da sich die Narbe anfangs noch im Umbauprozess befindet und empfänglich für Außeneinwirkung ist. Zum anderen lautet das Credo: Geduld. Du musst bei der Narbenpflege einiges an Durchhaltevermögen an den Tag legen, aber es lohnt sich. Unsere Tipps für dich:
- Vermeide Spannungen: Enge oder kratzige Kleidung kann gerade frische Narben unnötig beanspruchen und reizen.
- Entzündungshemmer Zwiebel: Zwiebelextrakt ist nicht nur entzündungshemmend und keimtötend. Es hemmt auch die Überproduktion an Bindegewebe. Eine Kompresse mit frischem Zwiebelsaft oder das einfache Anlegen auf die Narbe empfiehlt sich also gerade bei hypertrophen Narben und Keloiden.
- Eincremen ist das A und O: Ob Olivenöl oder Ringelblumensalbe – wenn du eine elastische und geschmeidige Haut haben und damit die Wundheilung positiv beeinflussen möchtest, kommst du um das regelmäßige Eincremen nicht herum.
- Massieren: Auch die tägliche Massage der Narbe wirkt sich begünstigend auf deren Elastizität aus. Zudem wird die Durchblutung angeregt, was die Selbstheilungskräfte in Gang setzt. Wie du am besten massierst, erfährst du von Ärztin oder Physiotherapeut.
- Gesunde Lebensweise: Eine ausgewogene Ernährung mit vielen Vitaminen und Spurenelementen kurbeln die Wundheilung an. Nikotin hingegen bremst die Durchblutung und damit auch die Heilung.
- Die richtige Temperatur: Sowohl Hitze als auch Kälte kann gerade frisches Narbengewebe reizen und die Umbauprozesse ins Stocken bringen.
- Sonnenlicht dosiert einsetzen: Das mag für viele eine Hiobsbotschaft sein, aber direkte Sonneneinstrahlung und Solarien solltest du ein halbes bis ganzes Jahr nach der Wundheilung meiden. Der Grund: Da Bindegewebe keine Pigmentzellen besitzt, kann es sich auch nicht durch Bräunung gegen schädigende UV-Strahlen schützen.
Ärztliche Behandlung von Narben
Sollten die Beschwerden trotz aller Eigeninitiative über einen längeren Zeitraum anhalten und die Narbe gar beginnen zu wuchern, solltest du auf alle Fälle einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. Gerade atrophe und hypertrophe Narben sowie Keloide können nicht nur schmerzhaft sein, sondern auch deine Beweglichkeit einschränken und bei zu starkem Hervortreten als optisch störend empfunden werden. Je nach Ursache der Beschwerden kann der Arzt oder die Ärztin zu verschiedenen Behandlungsmethoden greifen:
- Schröpfen: Bei eher kleineren Narben im Gesicht oder am Hals kommt oft die sogenannte Unterdruck-Vakuum-Massage zum Einsatz. Hierbei verursachen Saugnäpfe einen Unterdruck, der die Narbe dehnt und massiert.
- Silikonbehandlung: Silikonpräparate gibt es zum Beispiel in Form von Cremes, Gelen, Auflagen oder Folien – sie halten das Wundareal feucht und geschmeidig und verhindern die Entstehung von hypertrophen Narben oder Keloiden.
- Abschleifen: Um die Hautfläche ebenmäßiger zu machen, können die Ränder sowie erhabene Teile von Narben mit einem speziellen Schleifgerät entfernt werden. Diese Methode kommt beispielsweise bei wulstigen Aknenarben im Gesicht zum Einsatz.
- Injektionen: Ist die Narbe eingesunken, also atroph, wird häufig Kollagen gespritzt, um sie gewissermaßen aufzufüllen. Ist die Narbe hingegen erhaben, greift man auf Cortisol (Glukokortikoide) zurück – es hemmt das Narbenwachstum.
- Vereisung: Hierbei wird das Bindegewebe erhabener Narben mit flüssigem Stickstoff vereist, was zum Wachstumsstopp führt.
- Druckbehandlung: Ob Kompressionsverbände, Kunststoffmasken oder Druckknöpfe – eine Druckbehandlung vermindert die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen. Dadurch wird die Kollagenreifung beschleunigt und erhabene Narben flachen ab.
- Laserbehandlung: Erhabene Narben können auch durch energiereiches Laserlicht und die daraus resultierenden Wärmeschäden abgetragen werden.
- Microneedling: Hierbei wird ein mit scharfen Mikronadeln bestückter Narbenroller über die Haut gerollt, was zu minimalen Hautverletzungen führt. Das wiederum löst Reize aus, die zur Kollagenproduktion führen – die Narben werden von innen nach außen aufgefüllt und die Haut glättet sich. Kommt bei atrophen Narben zum Einsatz – etwa nach einer schweren Akne.
- Operation: Führen die anderen Methoden nicht zum gewünschten Erfolg, kann das Narbengewebe per OP entfernt und eine Hauttransplantation durchgeführt werden. Darauf wird vorrangig bei sehr auffälligen Narben im Gesicht oder extrem verwachsenen Narben zurückgegriffen, die die Beweglichkeit erheblich beeinträchtigen.